Endometriose ▷ Symptome, Behandlung und Schlaganfallrisiko

Endometriose: Starke Schmerzen während der Menstruation und oftmals auch unabhängig vom Zyklus sind ein Leitsymptom (Foto: Jo Panuwat D | Shutterstock)
In diesem Artikel:
- Das Wichtigste in Kürze
- Was ist Endometriose?
- Beschwerden und Symptome
- Wie wird Endometriose diagnostiziert?
- Wie wird Endometriose behandelt?
- Erhöht Endometriose das Schlaganfall-Risiko?
Das Wichtigste in Kürze:
Für alle, die gleich in die Tiefe gehen und mehr wissen möchten: Hier geht es zur ausführlichen Version des Artikels.Endometriose ist eine chronische, gynäkologische Erkrankung. Die genauen Ursachen sind derzeit noch nicht genau bekannt. Bei einer Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter.
Die Symptome sind vielfältig und für Betroffene sehr belastend. Starke Schmerzen während der Menstruation und oftmals auch unabhängig vom Zyklus sind ein Leitsymptom. Neben unterschiedlichen Schmerzformen kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Verdauungsbeschwerden und eingeschränkter Fruchtbarkeit kommen. Weitere Beschwerden äußern sich in Müdigkeit und Erschöpfung, Allergien, Autoimmunkrankheiten und einer erhöhten Anfälligkeit für Infekte.
Wie wird eine Endometriose festgestellt?
Durch eine gründliche Befragung, Tast- und Ultraschalluntersuchung. Ergänzend kann die Erkrankung über eine Darmspiegelung, ein MRT und als kleiner operativer Eingriff über eine Bauchspiegelung mit Gewebeanalyse diagnostiziert werden. Eine neue Methode ist die Diagnostik über einen laborchemischen Speicheltest.
Es gibt mittlerweile gute Therapiemöglichkeiten:
- Operative Entfernung der Endometriose-Herde mit oft sofortiger Linderung der Beschwerden
- Über den Einsatz von Medikamenten lassen sich langfristig die Schmerzen lindern und das Fortschreiten der Erkrankung verhindern.
Durch Beeinflussung des weiblichen Hormonzyklus mittels Hormonen lässt sich die Endometriose eindämmen. Der Einsatz dieser Medikamente muss ärztlicherseits in Abhängigkeit von der Lebenssituation der Patientin entschieden werden.
- GnRH-Analoga trocknen die Endometriose-Herde bildlich gesehen aus, da sie von der Östrogenzufuhr abgeschnitten sind.
- Gestagene täuschen dem Körper eine Schwangerschaft vor und bewirken so das Schrumpfen der Endometriose-Herde.
- Die Pille lindert deutlich die Beschwerden einer Endometriose.
Schmerzmittel ermöglichen betroffenen Frauen ein unbelastetes Leben. Welches das richtige Präparat ist, muss jedoch unbedingt im ärztlichen Gespräch abgeklärt werden. Denn Schmerzen können sich trotz der Einnahme von Schmerzmitteln mit der Zeit verselbstständigen und dauerhaft anhalten
Endometriose erhöht das Schlaganfall-Risiko enorm.
Neueste umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Frauen mit Endometriose das Risiko für einen Schlaganfall um 34 Prozent erhöht ist. Der Grund dafür scheint der durch die Erkrankung stark erhöhte Östrogenspiegel zu sein. Dieser kann zu Blutgerinnseln führen.
Gezielte Therapiemaßnahmen können dieses Risiko senken.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Was ist Endometriose?
Die Endometriose ist eine gutartige, allerdings chronisch verlaufenden Erkrankung, deren genaue Ursache noch nicht bekannt ist.
Bei einer Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Im Prinzip kann dieses Gewebe an jeder Stelle des Körpers wachsen: vor allem an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, am Darm oder Bauchfell und, wenn auch selten, in der Lunge.
Beim Eindringen von Endometriosegewebe in tiefere Schichten des Beckenraums wie in die Harnblase oder Darmwand, spricht man auch von einer tief infiltrierenden Endometriose.
Was ist das Endometrium?
Das Endometrium ist die Schleimhaut, die die Gebärmutter von innen auskleidet. Es wird auch Gebärmutterschleimhaut genannt.
Das Endometrium verdickt sich im Rahmen des Menstruationszyklus, um die Einnistung einer befruchteten Eizelle vorzubereiten. Sollte sich keine Eizelle einnisten, wird die obere Schicht des Endometriums abgestoßen und ausgeschieden. Letzteres nennt man Menstruation oder umgangssprachlich auch Periode.
Beschwerden und Symptome: Wie äußert sich die Endometriose?
Die Beschwerden und Symptome sind bei einer bestehenden Endometriose unterschiedlich. Das erschwert sehr häufig die Diagnose.
Starke Menstruationsschmerzen sind ein Leitsymptom. Die Schmerzen können jedoch auch unabhängig vom Zyklus vorkommen und im ganzen Körper auftreten.
Liste der bei Endometriose auftretenden Beschwerden und Symptome
- starke, oft krampfartige Schmerzen vor und während der Menstruation
- wiederkehrende Schmerzen im Unterbauch, besonders in der zweiten Hälfte des Monatszyklus
- Unterbauchschmerzen unabhängig von der Periode
- Zwischenblutungen und starke Menstruation
- Schmerzen im Bauch und Rücken
- Schmerzen bei der vaginalen Penetration, also beim Sex, oder danach
- Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen
- Schmerzen beim Stuhlgang und/oder Urinieren
- zyklische Blutungen aus Darm und/oder Blase
- Übelkeit und Erbrechen
- Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Durchfall und Verstopfung
- eingeschränkte Fruchtbarkeit
Ferner kann es mit den genannten Symptomen auch zu nachgenannten Folgen kommen:
- Müdigkeit und Erschöpfung
- vermehrtes Auftreten von Allergien und bestimmten Autoimmunerkrankungen
- erhöhte Infektanfälligkeit (insbesondere während der Menstruation)
Untersuchungsmethoden: Wie wird Endometriose diagnostiziert?
Beim Verdacht auf Endometriose sind nachfolgend genannte Untersuchungen angezeigt:
- Anamneseerhebung mit ausführlicher Befragung über den Allgemeinzustand und die Schmerzsymptomatik
- Tastuntersuchung, wobei neben der gynäkologischen Untersuchung der Vagina ebenfalls der Enddarm, der Bereich hinter der Gebärmutter und die Gebärmutterbänder abgetastet werden müssen
- Ultraschall-Untersuchung sowohl durch die Vagina (vaginale Sonographie) als auch durch die Bauchdecke (abdominale Sonographie)
- Ergänzt werden kann die umfassende Untersuchung, je nach Beschwerden, beispielsweise mittels einer Darmspiegelung oder eines sogenannten bildgebenden Verfahrens wie der Magnetresonanztomografie (MRT).
- Auch per Bauchspiegelung, der Laparoskopie, lässt sich die Diagnosestellung maßgeblich unterstützen. Bei diesem kleinen operativen Eingriff wird eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen und untersucht. Hierbei können zudem Lage, Schweregrad und Wachstumstyp festgestellt werden.
- Ferner gibt es seit Kurzem die Möglichkeit, mithilfe eines laborchemischen Speicheltests eine Endometriose zu diagnostizieren. Die Kosten dieser Diagnose werden derzeit allerdings noch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Fehldiagnosen
Bedingt durch die unterschiedlichsten Beschwerde- und Symptombilder, werden Fehldiagnosen wie Entzündungen der Eierstöcke, psychische Beschwerden oder das prämenstruelle Syndrom (PMS) häufiger gestellt als die richtige Diagnose.
Wie wird Endometriose behandelt?
Auch wenn Endometriose eine chronisch verlaufende Erkrankung ist, so bedeutet dies nicht, dass Erkrankte diesem Leiden hilflos ausgeliefert sind.
Es gibt eine Reihe von Therapieformen, die die Beschwerden lindern und mit oft dauerhaftem Erfolg behandelt werden können.
Allen voran steht fast immer die kombinierte Behandlung. Sie ist daher am erfolgreichsten, weil sie den operativen Eingriff mit einer medikamentösen Behandlung verknüpft.
Operativer Eingriff
Heutzutage können Endometriose-Herde mit kleinsten chirurgischen Instrumenten sehr gut entfernt werden. Beschwerden lassen sich dadurch oft sofort und auch langfristig in Verbindung mit Medikamenten lindern.
Medikamentöse Therapie
Der Einsatz von Medikamenten bei der Endometriose-Behandlung verfolgt zwei Ziele:
- die Linderung der Beschwerden, insbesondere der Schmerzen und
- die Hinderung des Fortschreitens der Erkrankung.
Dazu stehen bestimmte Wirkstoffgruppen zur Verfügung.
Hormone
Die Gabe von Hormonen soll der Endometriose durch Beeinflussung des weiblichen Hormonzyklus Einhalt gebieten. Dies geschieht durch Unterdrückung der natürlichen Hormonveränderungen im Rahmen des Menstruationszyklus.
Hierzu gibt es drei unterschiedliche Substanzgruppen aus dem Bereich der Hormone:
- GnRH-Analoga
- Gestagene
- Die Pille
Der Einsatz dieser Medikamente muss ärztlicherseits in Abhängigkeit von der Lebenssituation der Patientin entschieden werden.
GnRH-Analoga
GnRH, aus dem Englischen für „Gonadotropin Releasing Hormone" ist ein Zwischenhirn-Hormon, welches bei Frauen die Hirnanhangsdrüse und in Folge die Eierstöcke zur Bildung weiblicher Geschlechtshormone anregt.
Die Verabreichung von GnRH-Analoga, also Wirkstoffen, die dem GnRH ähneln, blockiert die Funktion der Hirnanhangsdrüse und unterbricht somit den normalen Menstruationszyklus. Dadurch nimmt die Bildung von Östrogenen ab, wodurch sich die betroffene Person für etwa vier bis sechs Monate in einem künstlichen Zustand der Wechseljahre befindet. Die Endometriose-Herde trocknen bildlich gesehen aus, da sie von der Östrogenzufuhr abgeschnitten sind.
Gestagene
Progesteron ist ein Hormon aus der Gestagen-Gruppe. Es wird nach dem Eisprung von den Eifollikeln gebildet und ist normalerweise für die Schwangerschaft wichtig.
Wenn Progesteron-ähnliche Wirkstoffe verabreicht werden, so wird dem Körper ein Schwangerschaftszustand vorgetäuscht und die Funktion der Eierstöcke blockiert. In der Folge kommt es zu einem „Austrocknen" beziehungsweise einem Schrumpfen der Endometriose-Herde. Erfahrungsgemäß lassen die Beschwerden nach sechs bis acht Wochen nach.
Die Pille
Zur Behandlung der Endometriose kann auch die normalerweise zur Schwangerschaftsverhütung verordnete sogenannte Pille eingesetzt werden. Vor allem dann, wenn die Beschwerden sich auf die Zeit der Periodenblutung beschränken.
Durch eine über mehrere Monate durchgehende Einnahme können die Beschwerden deutlich gelindert werden. Dies gilt insbesondere bei der sogenannten Gestagen-betonten Version des Medikaments.
Schmerzmittel
Schmerzmittel ermöglichen betroffenen Frauen eine Beschwerdelinderung, um ein möglichst unbelastetes Leben zu führen.
Wichtig vor der Einnahme von Schmerzmitteln
Hier ist die Absprache mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt in Bezug auf das richtige Präparat und die richtige Dosierung unbedingt erforderlich. Denn Schmerzen können sich trotz der Einnahme von Schmerzmitteln mit der Zeit verselbstständigen und dauerhaft anhalten.
Erhöht Endometriose das Schlaganfall-Risiko?
Leider verursacht eine Endometriose nicht nur vielfältige Beschwerden. Sie wird auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und besonders mit dem Schlaganfall in Verbindung gebracht.
Neueste umfangreiche Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass bei Frauen mit Endometriose das Risiko für einen Schlaganfall um 34 Prozent erhöht ist.1 Der Grund dafür scheint der bei Endometriose zu hohe Östrogenspiegel zu sein, der zu Blutgerinnseln führen kann.
Demzufolge ist eine umfassende und genaue Abklärung bei den oben beschriebenen Beschwerden und Symptomen sowie eine zielgerichtete Therapie das oberste Gebot. So kann das Risiko schwerwiegender Folgeerkrankungen deutlich gesenkt werden.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Frau
- Hormonersatztherapie: Erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall?
- Überblick über die Risikofaktoren eines Schlaganfalls
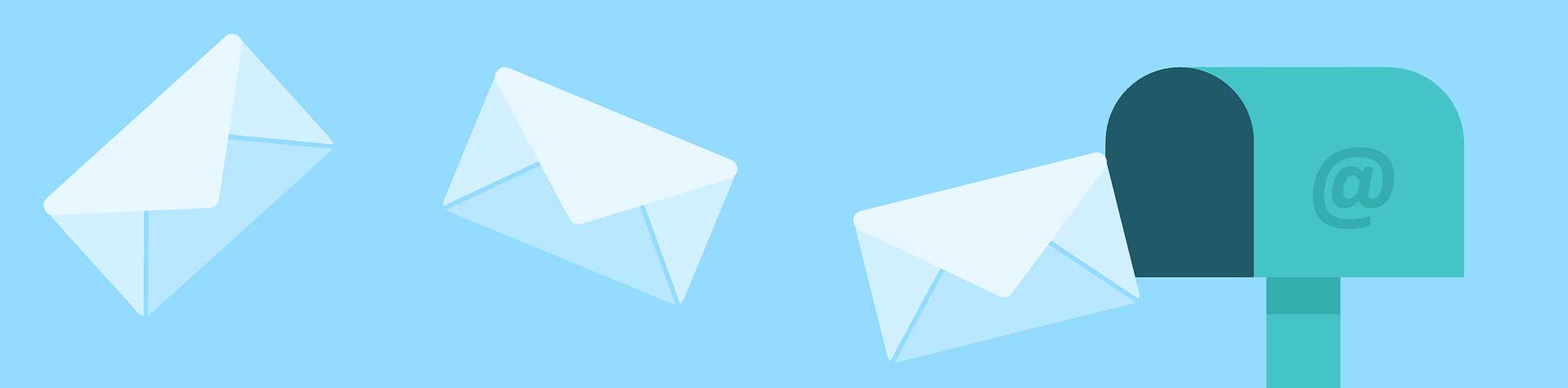
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autor
Dr. med. Mark Dankhoff ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin, Diabetologische Grundversorgung, Hypertensiologie DHL, Adiposiologie DAG/AGA/DDG, Adipositas-Trainer AGA, Medizinischer Berater. Sein Schwerpunkt ist die Prävention und Therapie von kardiovaskulären Risikofaktoren und Erkrankungen. Seit 2021 ist er als Medical Advisor freiberuflich tätig. Dr. med. Mark Dankhoff ist Gründungsmitglied des „Im Puls. Think Tank Herz-Kreislauf e.V.“. [mehr]
Quellen
- Laparoscopically Confirmed Endometriosis and Risk of Incident Stroke: A Prospective Cohort Study - Autoren: Leslie V. Farland et al. - Publikation: Stroke, 21 Juli 2022 - DOI: 10.1161/STROKEAHA.122.039250Stroke
- Prevalence and incidence of diagnosed endometriosis and risk of endometriosis in patients with endometriosis-related symptoms: findings from a statutory health insurance-based cohort in Germany - Autoren: Abbas, Sascha; Ihle, Peter; Köster, Ingrid; Schubert, Ingrid - Publikation: European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 160 (1), 2012, 79–83.
- Epidemiology of endometriosis: a large population-based database study from a healthcare provider with 2 million members - Autoren: Eisenberg, VH; Weil, C; Chodick, G; Shalev, V. - Publikation: BJOG, 125(1), 2017, 55–62.
- The Main Theories on the Pathogenesis of Endometriosis - Autoren: Lamceva, Jelizaveta; Uljanovs, Romans; Strumfa, Ilze - Publikation: International Journal of Molecular Sciences, 24(5), 2023, 42–54.
- Endometriose - Autoren: Mettler, Liselotte; Schmutzler, Andreas - Publikation: Diedrich, Klaus u.a. (Hrsg.): Gynäkologie und Geburtshilfe. Springer-Lehrbuch. Springer: Berlin, Heidelberg. 2007.
- High prevalence of endometriosis in infertile women with normal ovulation and normospermic partners. - Autoren: Meulemann, Christel et al. - Publikation: Fertility and Sterility 92(1),2009, 68–74.
- Publikation: Robert-Koch-Institut (Hrsg.). Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Gemeinsam getragen von RKI und Destatis. Gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland. Berlin. 2020. 74–76.
- Die Darstellung der Erkrankung - Autor: Ulrich, Uwe Andreas - Publikation: Becherer, E. und Schindler, A. E. (Hrsg.). Endometriose ganzheitlich verstehen und behandeln. Ein Ratgeber (4., erweiterte und überarbeitete Auflage), 2023.
- Endometriose in der vertragsärztlichen Versorgung – Regionale und zeitliche Trends im Zeitraum 2012 bis 2022. (2024). - Autoren: Kohring, C., Holstiege, J., Heuer, J., Dammertz, L., Brandes, I., Mechsner, S. & Akmatov, M.
- Inzidenz der Endometriose von 2014 – 2022. Analyse von bundesweiten vertragsärztlichen Abrechnungsdaten. - Autoren: Kohring, C., Akmatov, M. K., Holstiege, J., Brandes, I. & Mechsner, S. - Publikation: Deutsches Ärzteblatt International, 121(19), 2024, 619–626.


