Karotisoperation: Weniger Risiko durch Ultraschallüberwachung ▷ Studie

Die hirnversorgenden Halsarterien lassen sich gut per Ultraschall untersuchen. (Foto: RossHelen | Shutterstock)
In diesem Artikel:
- Das Wichtigste in Kürze
- Karotisstenose als Ursache für den Schlaganfall
- Wie wird eine Karotisstenose festgestellt?
- Behandlung und mögliche Risiken
- Traditionelle Vorsorgemaßnahmen bei Eingriffen an der Halsschlagader
- Studie zur intraoperativen Risikoreduktion durch Ultraschall
Das Wichtigste in Kürze:
Für alle, die gleich in die Tiefe gehen und mehr wissen möchten: Hier geht es zur ausführlichen Version des Artikels.Eine Hauptursache für das Entstehen von Schlaganfällen sind arteriosklerotische Einengungen, sogenannte Stenosen, oder Verschlüsse der zum Hirn führenden Halsschlagadern, den Arteriae Carotides.
Wird im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung oder Angiografie eine Karotisstenose festgestellt, gibt es zwei Möglichkeiten der Therapie:
- einen gefäßchirurgischen Eingriff durch eine Ausschälplastik der Verkalkungen, die sogenannte Thrombendarterektomie
- die radiologisch-interventionelle Technik durch Aufdehnung der Stenose und Einsetzen einer Gefäßstütze, des Stents, mittels eines Katheters
Erfolg und Risiko der Behandlung einer Karotisstenose
Ausschälplastiken oder interventionelle Eingriffe sind heutzutage etablierte Verfahren in der Behandlung von Einengungen an den Halsschlagadern. Das Hauptrisiko ist weiterhin das Entstehen einer Minderdurchblutung. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Schlaganfall während der Operation oder Intervention.
Verschiedene Methoden haben das Risiko schon deutlich gesenkt:
- verfeinerte Operations- und Überwachungstechniken
- der Einsatz von Überbrückungsröhrchen, sogenannte Shunts
- Operationen am wachen Patienten in örtlicher Betäubung
Nun hat eine Studie gezeigt, dass der kontinuierliche Einsatz einer Ultraschallsonde feine Embolien deutlich vermindert. Gleichzeitig aktiviert diese Methode das körpereigene gerinnungshemmende System während des Eingriffs.
Die Ultraschall-Auflösungsbehandlung, die Sonolyse, kann zukünftig Bestandteil der invasiven, operativen oder angioplastischen Eingriffe an der Halsschlagader werden. Mit diesem Verfahren lässt sich die Sicherheit der Betroffenen weiter verbessern.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Karotisstenose als Ursache für den Schlaganfall
Für die Entstehung eines Schlaganfalls gibt es eine Reihe von Ursachen. Insofern ist immer eine differenzierte Diagnostik notwendig.
Die Hauptursache ist ein verminderter oder komplett unterbrochener Blutfluss durch die Einengung (Stenose) oder den Verschluss einer hirnversorgenden Arterie. Die Folge ist ein Sauer- und Nährstoffmangel mit entsprechendem Funktionsausfall im abhängigen Hirnbereich. Es kommt zu einem Hirninfarkt. Auch durch eine Stenose abgeschwemmte Blutgerinnsel können einen Hirninfarkt verursachen.
Eine Stenose kann vor allem an den Halsschlagadern, den Arteriae carotides auftreten.
Anatomie der hirnversorgenden Arterien
Zum Gehirn führen vier große oder größere Arterien. Sie verlaufen am Hals hoch zur Schädelbasis und gelangen dann durch entsprechende Öffnungen zum Gehirn.
Entsprechend unterscheidet man einen extrakraniellen, außerhalb des Schädels gelegenen und einen intrakraniellen, innerhalb des Schädels gelegenen Verlauf der paarig rechts und links angelegten Arterien.
Die dünneren Wirbel-Arterien, Arteriae vertebrales haben ihren Ursprung in der Armarterie, der Arteria subclavia und verlaufen durch die Querfortsätze der Halswirbel hirnwärts. Sie versorgen im Schädel vor allem den Hirnstamm, das Kleinhirn und hintere Hirnanteile.
Die deutlich kräftigeren Halsschlagadern, Arteriae carotides verlaufen vorn seitlich am Hals. Sie zweigen sich etwa in Höhe des Kieferwinkels auf:
-
- in eine innere Arterie, die Arteria carotis interna, die grosse Anteile des Großhirns versorgt
und
- in eine äußere Arterie, die Arteria carotis externa. Sie versorgt die Weichteile von Gesicht und Kopf, den Schädelknochen und die Hirnhäute.
Diagnostik: Wie wird eine Karotisstenose festgestellt?
Die hirnversorgenden Halsarterien sind gut über nicht-invasive Ultraschalluntersuchungen wie die Doppler- und Duplexsonographie zugänglich.
Sind Risikofaktoren für eine Arteriosklerose bekannt, ist es sinnvoll, im Rahmen einer fachärztlichen Vorsorgeuntersuchung eine Ultraschalldiagnostik durchzuführen. Durch diese Untersuchung lassen sich entsprechende relevante Veränderungen erkennen oder ausschließen.
Im positiven Fall muss sich dann meist eine noch detailliertere Darstellung in Form einer Kontrastmittel-, CT- oder MRT-Angiografie anschließen.
Behandlung der Karotisstenose
Gefäßchirurgischer Eingriff
Ziel der Therapie ist es, die Engstelle und möglichst gleichzeitig arteriosklerotische Wandveränderungen zu beseitigen, da sie Gerinnselbildungen begünstigen.
Eine seit langer Zeit etablierte operative Methode ist die lokale Ausschälplastik, die sogenannte Thrombendarterektomie der Arteria carotis interna.
Aufzweigungen begünstigen aufgrund von Strömungsturbulenzen die Bildung arteriosklerotischer Wandveränderungen. Daher finden sich die ausgeprägtesten Einengungen an den Halsschlagadern meist im Aufzweigungsbereich von innerer und äußerer Halsschlagader.
Wir läuft die Operation ab?
Über einen kleinen Schnitt im vorderen, mittleren Halsbereich lässt sich die gemeinsame Halsschlagader, die Arteria carotis communis freilegen und abklemmen. Dann folgen die beiden Hauptäste Arteria carotis externa und interna. Im nächsten Schritt wird das Gefäß über der meist gut tastbaren Einengung von der gemeinsamen in die innere Halsschlagader hinein eröffnet.
Während dieser Maßnahmen ist der Blutfluss zum Gehirn zwangsläufig auf der entsprechenden Seite unterbrochen. Um eine ausreichende Blutzufuhr zu gewährleisten, kann man mit besonders konfigurierten feinen Röhrchen, sogenannten Shunts, den abgeklemmten Gefäßabschnitt überbrücken.
Solche Eingriffe müssen von erfahrenen Gefäßchirurginnen oder -chirurgen so zügig wie möglich durchgeführt werden. Denn natürlich spielt auch die Dauer der unterbrochenen Blutzufuhr eine Rolle.
Die arteriosklerotischen Veränderungen und Verkalkungen werden dann im Bereich der mittleren Wandschicht mit feinen Instrumenten abgelöst, über die gesamte Länge ausgeschält und schließlich – das ist besonders wichtig – komplett entfernt.
Sollte in Strömungsrichtung doch eine kleine Stufe verbleiben, muss diese mit feinsten Nähten fixiert werden, sodass ein glatter Übergang gewährt ist. Ansonsten drohen hier eine Gerinnselbildung und eine erneute Engstelle bis zum akuten Verschluss.
Nach Fertigstellung dieser Ausschälplastik wird sorgfältig ausgespült, der Einschnitt in der Arterie mit feiner Naht verschlossen oder gegebenenfalls auch ein Erweiterungsflicken eingenäht. Dabei wird sorgfältig entlüftet. Falls ein Shunt vorhanden ist, wird dieser entfernt. Schließlich gibt man den Blutstrom nach endgültigem Knoten der Naht wieder frei.
Radiologisch-interventionelles Vorgehen
Alternativ kann die betreffende Engstelle mittels Ballonaufdehnung und Einsetzen einer Gefäßstütze, dem Stent behoben werden. Bei günstigen Voraussetzungen trifft das sogar auf einen Verschluss zu.
Auch bei dieser Technik und insbesondere bei Blutgerinnseln im Bereich der Stenose besteht die erhöhte Gefahr, dass diese in den Hirnkreislauf geraten. Andererseits kann die Zeit der Blutflussunterbrechung durch die Ballonaufdehnung oder den Stent sehr kurz gehalten werden.
Traditionelle Vorsorgemaßnahmen bei Eingriffen an der Halsschlagader
Das Hauptrisiko bei beiden Verfahren ist also der Schlaganfall. Sei es durch die Unterbrechung des Blutflusses oder durch die Verschleppung feinster Luftbläschen, Gerinnsel oder Kalkreste.
Daher wurden in der Medizin der letzten Jahrzehnten einige Vorsorgemaßnahmen entwickelt.
Imperato und die Quietsche-Entchen-Methode
Ein wesentlicher Fortschritt war bei dem operativen Vorgehen die Einführung der örtlichen Betäubung anstelle der Vollnarkose. Schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte der amerikanische Gefäßchirurg Imperato diese Technik erstmals propagiert.
Die Operierten bekamen ein Quietscheentchen in die gegenseitige Hand gedrückt. Während der Abklemmzeit der Arterie forderte man sie regelmäßig auf, das Entchen durch Zusammenpressen zum Quietschen zu bringen.
Diese simple akustische Information zeigte, dass die Durchblutung noch ausreichend war. Zeigte sich demgegenüber eine Schwäche, also eine Parese der zur Operation gegenseitigen Hand, so wurde ein Überbrückungsröhrchen, ein Shunt, eingelegt.
Mit einer speziellen Ultraschallsonde ließ sich auch durch eine spezielle Knochenlücke im Schädel der Blutfluss in der inneren Hirnarterie messen und kritische Verminderungen feststellen. Diese Methode wird transkranielle Dopplersonographie genannt.
Zusätzlich brachte man weitere Vorsorgemaßnahmen zum Einsatz:
- sorgfältiges Ausspülen und sorgfältige Entlüftung des OP-Gebietes
- Freigabe des Blutstromes erst in die äußere und erst dann in die innere Halsschlagader
Ultraschall: Vorteile in jeder Operationsphase
Die Ultraschalluntersuchung der Hirnarterien und hier insbesondere des kräftigsten Astes, der mittleren Hirnarterie (Arteria cerebri media), ist heute ein Standard. Vor einer Operation, um die Durchblutung beurteilen zu können, und während einer Operation, um früh genug Flussverminderungen zu erkennen.
Der Ultraschall ist aber auch dafür bekannt, dass er feinste Gerinnsel und sogar Luftbläschen oder feinste Kalkfragmente zerkleinern und damit unschädlich machen kann. Gleichzeitig kann er gerinnungsaktive Substanzen vermindern, das körpereigene Gerinnsel auflösende Fibrinolysesystem aktivieren und die feinen Endarterien erweitern.
Studie: intraoperative Risikoreduktion durch Ultraschall
Ein neuer Ansatz der intraoperativen Risikoreduktion wurde jetzt im „New England Journal of Medicine“ beschrieben.
Die positiven Eigenschaften des Ultraschalls hat man in einer großen doppelblind randomisierten Studie1 während Thrombendarterektomien untersucht.
Insgesamt 1004 Patienten und Patientinnen mit einer symptomatischen oder asymptomatischen Karotisstenose von mehr als 70 Prozent wurden blind einer der beiden Gruppen mit kontinuierlicher oder ohne kontinuierliche Ultraschallbeschallung zugeordnet.
Die Ultraschallsonde wurde mit einem Band in typischer Weise am Schädel außen fixiert. Dann wurde mit einer üblichen Frequenz von 2 MHz nur kurz bei Bedarf ein diagnostischer Schall mit einer Dauer von weniger als 2 Minuten vorgenommen. In der therapeutischen Gruppe beschallte man die mittlere Hirnarterie kontinuierlich über die gesamte Operation mit der gleichen Frequenz.
Das operative Vorgehen folgte den typischen Standards nach Entscheidung und Präferenz der jeweiligen operierenden Person. Im Bezug auf
-
- Anästhesieverfahren (Vollnarkose versus Lokalanästhesie)
und
- Shunt-Einlage oder Gefäßrekonstruktion mittels direkter Naht oder Patch-Verschluss.
Als sogenannter „primärer Endpunkt“ wurden mehrere Folgeszenarien untersucht:
- ein Schlaganfall
- eine vorübergehende Minderdurchblutung, also die sogenannte transitorisch ischämische Attacke (TIA)
- die Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach der Operation.
Zusätzlich wurde in einer Subgruppenanalyse bei jeweils ungefähr 240 Patientinnen und Patienten eine Kernspinuntersuchung (MRT) durchgeführt. So sollten neu innerhalb von 24 Stunden nach der Operation aufgetretene Infarktareale erkannt werden.
Studienergebnisse
Beide Untersuchungen zeigten einen signifikanten Vorteil der kontinuierlichen therapeutischen Ultraschall-Einwirkung:
Der primäre Endpunkt – Schlaganfall, TIA oder Tod – trat bei 2,2 Prozent in der therapeutischen Ultraschallgruppe gegenüber 7,6 Prozent bei üblichem Vorgehen auf. Neue, auch sehr kleine Infarktareale bei der MRT-Untersuchung zeigten sich bei 8,5 Prozent nach Ultraschall gegenüber 17,4 Prozent bei Standardvorgehen.
Diese Ergebnisse sprechen eindeutig für einen positiven Effekt der Ultraschallbestrahlung.
Schlussfolgerung und Ausblick des Autors
Die transkranielle, also durch Knochenlücken des Schädels direkt an den inneren Hirnarterien durchgeführte Ultraschalluntersuchung des Blutflusses ist ein standardisiertes Verfahren. Sowohl vor als auch während der Operationen oder der Interventionen an den Halsschlagadern. In geübten Händen ist sie ohne großen Aufwand und sicher einzusetzen.
Der in der Studie vorgestellte kontinuierliche therapeutische Einsatz verwendet im Prinzip diese etablierte Technik. Er stellt also keinen besonderen zusätzlichen Aufwand dar und beeinflusst auch den operativen Ablauf nicht.
Mit diesem Verfahren lässt sich die Sicherheit der Betroffenen weiter verbessern.
Insofern würde ich erwarten, dass diese intraoperative Sonolyse zumindest an spezialisierten Zentren Eingang in die Routine findet, auch, um mithilfe noch größerer Patientengruppen weitere Ergebnisse zu erhalten.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Kann auch der Zahnarzt Einengungen der Halsschlagader erkennen?
- Die Ursachen des Schlaganfalls
- Überblick über die Risikofaktoren für einen Schlaganfall
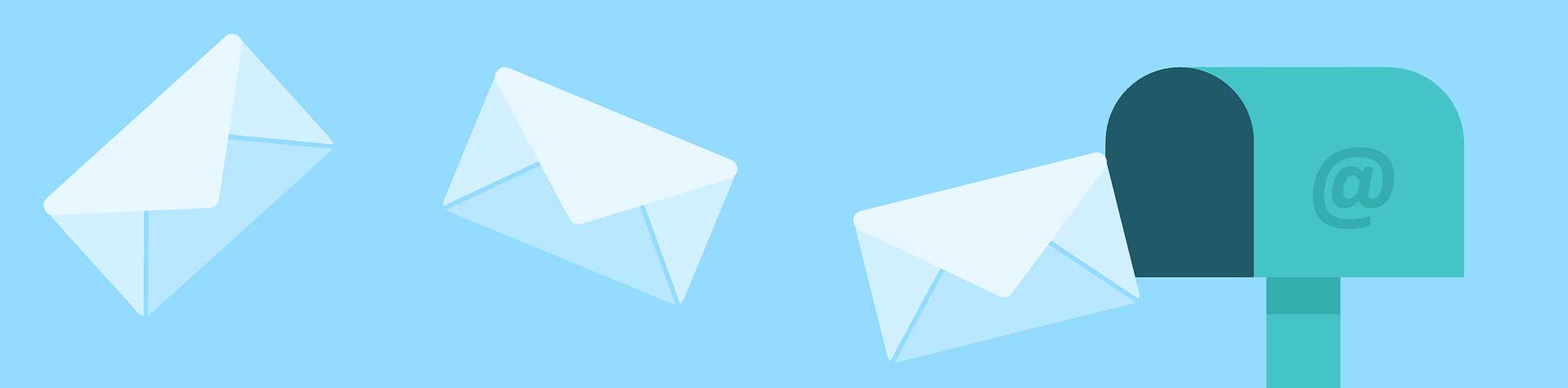
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:
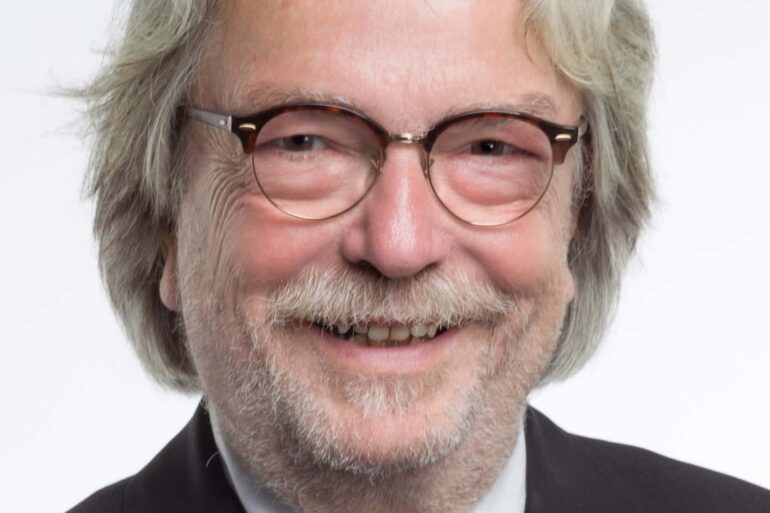
Autor
Prof. Dr. med. Rainer Moosdorf widmet sich seit mehr als 35 Jahren der Herz- und Gefäßchirurgie. Die Schwerpunkte innerhalb der Herz- und Gefäßchirurgie sind Laser- und Arrhythmiechirurgie, endovaskuläre Verfahren einschließlich TAVI’s und endovaskuläre Rekonstruktionen des Aortenbogens, rekonstruktive Chirurgie der Herzkranzgefäße und noch einige Arten der “Französischen Korrektur”. Als Vorstandsvorsitzender des “Medizinischen Netzwerks Hessen” ist er offizieller Vertreter des Landes Hessen auf dem Gebiet der klinischen Medizin und der medizinischen Ausbildung. [mehr]
Quelle zur Studie
- Sonolysis during carotid endarterectomy: randomised controlled trial. - Autoren: Školoudík D, Hrbáč T, Kovář M, Beneš V 3rd, Fiedler J, Branca M, Rossel JB, Netuka D; SONOBIRDIE Trial Investigators - Publikation: BMJ. 2025 Mar 19;388:e082750 - DOI: 10.1136/bmj-2024-082750


