Fette und Krankheiten ▷ Ernährung als Risiko und Prävention

Der Verzehr von überwiegend ungesunden Fetten kann langfristig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettstoffwechselstörungen führen (Foto: Chalee2500 | Shutterstock)
In diesem Artikel:
- Das Wichtigste in Kürze
- Referenzwerte für den Fettstoffwechsel
- Arten von Fettstoffwechselstörungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge von Fettstoffwechselstörungen
- Tipps zur Umstellung von ungesunden auf gesunde Fette
- Nahrungsfette in Milchprodukten: Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
- Nahrungsfette und ihre Rolle in der Entstehung von Krebs
- Chemie der Fettsäuren
Das Wichtigste in Kürze:
Für alle, die gleich in die Tiefe gehen und mehr wissen möchten: Hier geht es zur ausführlichen Version des Artikels.Das Risiko für Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen lässt sich durch regelmäßige Untersuchungen und anhand optimaler Referenzwerte und Zielwerte feststellen.
Das betrifft folgende Blutfettwerte:
- Gesamtcholesterin
- LDL-Cholesterin
- Non-HDL-Cholesterin
- HDL-Cholesterin
- Triglyceride
Auch das Lipoprotein (a) sollte mindestens einmal im Erwachsenenleben bestimmt werden.
Weitere Hinweise auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen liefert das Verhältnis von ApoB-100 zu ApoA1. Nach neuem Erkenntnisstand ist das Risiko möglicherweise besser vorauszusagen als das bisher gerne verwendete Verhältnis von LDL-Cholesterin zu HDL-Cholesterin.
Je nachdem, welche Blutwerte erhöht sind, unterscheidet man 7 verschiedene Profile von Fettstoffwechselstörungen:5
- erhöhtes LDL-Cholesterin
- erhöhtes LDL-Cholesterin in Kombination mit erhöhten Triglyceriden
- erhöhte Triglyceride
- niedriges HDL-Cholesterin
- erhöhtes LDL-Cholesterin und/oder erhöhte Triglyceride, begleitet von niedrigem HDL-Cholesterin
- erhöhtes Apolipoprotein B bei gleichzeitig normalen LDL-Cholesterinwerten
- erbliche Lipoproteinstörungen, wie familiär erhöhte Cholesterin- und/oder Triglyceridwerte
Vor allem, wenn noch keine Gefäßveränderungen der Halsschlagader festgestellt werden, können Statine dem arteriosklerotischen Prozess im Frühstadium entgegenwirken. Damit es gar nicht erst zur Notwendigkeit einer Behandlung mit Medikamenten kommt, ist eine Anpassung der Ernährung entscheidend.
Unsere Ernährung beeinflusst die Entstehung von Krankheiten
Die Ernährung hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Der Verzehr von überwiegend ungesunden Fetten kann langfristig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettstoffwechselstörungen führen.
Ein hoher Fettkonsum wird auch immer wieder mit der Entstehung verschiedener Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. Die Studienlage hierzu ist nicht eindeutig.9,10
Es ist also von enormer Bedeutung, frühzeitig Quellen für ungesunde Fette in unserer Ernährung zu erkennen und diese durch Quellen zu ersetzen, die reich an gesunden Fetten sind.
Wie kann man der Entstehung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und Fettstoffwechselstörungen über die Ernährung vorbeugen?
Fett ist ein wichtiger Energielieferant für unseren Körper. Daher ist es nicht sinnvoll, Fette in großem Umfang aus der Ernährung zu streichen. Wichtig ist jedoch, nicht mehr als 30 bis 35 Prozent der täglich über die Nahrung zugeführten Energie aus Fetten zu beziehen.1,2 Etwa 60 bis 80 Gramm Fett sind für Erwachsene mit geringer körperlicher Aktivität ein guter Richtwert.6
Entscheidend ist vor allem, welche Fette in welchem Maß verzehrt werden. Es gibt „gute” und „schlechte” Fette.
Besonders der übermäßige Verzehr von Trans-Fetten und gesättigten Fettsäuren hat einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit. Der Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Gehalt an Trans-Fettsäuren sollte auf ein Minimum reduziert werden.
Zudem empfiehlt sich ein eher zurückhaltender Konsum von Lebensmitteln mit gesättigten Fetten. Meiden Sie also möglichst Fertigprodukte, Fast Food, frittierte Speisen und Produkte, in deren Inhaltsangaben Begriffe wie „teilgehärtet” oder „hydrogenisiert” stehen.
Den größten Anteil der verzehrten Fette sollten die ungesättigten Fette ausmachen. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung von Lebensmitteln, die reich an den mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren sind.
Wichtig ist aber auch, die Gesamtmenge an Fett nicht zu steigern. Denn überschüssiges, mit der Nahrung aufgenommenes Fett - egal, ob gut oder schlecht - führt zu einer Gewichtszunahme.
Zu Beginn einer Stoffwechselstörung ist es sinnvoll, den Verzehr von Fett im Allgemeinen zu reduzieren. Vor allem gesättigte Fette und Cholesterin sollten nur in Maßen verzehrt werden. Gleichzeitig sollte die Ernährung weniger einfache Zucker und stattdessen mehr komplexe Kohlenhydrate, beispielsweise in Form von Vollkornprodukten, enthalten. Die Menge an Protein kann üblicherweise beibehalten werden.5
Wie erfolgreich eine Ernährungsumstellung oder lipidsenkende Medikamente die Blutfette senken können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel:
- Alter
- Körperbau
- Vererbung
- Umweltfaktoren
Steigern oder senken Nahrungsfette in Milchprodukten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Die Studienlage ist nicht eindeutig. Während einige Studien darauf hindeuten, dass Milchprodukte das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, zeigen andere das genaue Gegenteil.
Wer gerne Milch und Milchprodukte in großen Mengen verzehrt, profitiert möglicherweise von Milchprodukten, deren Fettsäurezusammensetzung verbessert wurde.
Bio-Milch und Bio-Milchprodukte enthalten mehr einfach und mehrfach ungesättigte sowie weniger gesättigte Fettsäuren als konventionelle Milch. Auch Weidemilch hat ein günstigeres Fettsäureprofil.8
Viele Milchersatzprodukte, darunter Soja-, Hafer- und Mandeldrinks, weisen ebenfalls einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren auf. Sie sind hinsichtlich der Nahrungsfette eine gute Alternative zu tierischer Milch.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Referenzwerte für den Fettstoffwechsel: Welche Blutwerte sind normal?
Gesamtcholesterin
Ein Gesamtcholesterin im Serum von unter 200 mg/dL (unter 5,2 mmol/L) ist wünschenswert.
Werte von 200 bis 290 mg/dL beziehungsweise 5,2 bis 7,5 mmol/L gelten als grenzwertig erhöht. Ab diesen Werten ist eine zusätzliche Bestimmung des HDL- und LDL-Cholesterins für die Einschätzung des Risikos notwendig.
Hohes Cholesterin liegt vor, wenn Werte von über 290 mg/dL (über 7,5 mmol/L) gemessen werden.
Von einem hohen Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung muss ausgegangen werden, wenn die Laborwerte 310 mg/dL (8,0 mmol/L) überschreiten.3
LDL-Cholesterin
LDL steht für “low density lipoprotein”, also Lipoproteine mit geringer Dichte. LDL-Cholesterin gilt als bedeutender Risikofaktor für die Arteriosklerose.
Ein LDL-Cholesterin-Wert von 70 bis unter 100 mg/dL (1,8 bis unter 2,6 mmol/L) gilt als niedrig. Werte von 100 bis unter 116 mg/dL (2,6 bis unter 3,0 mmol/L) werden als normal eingestuft. Diese Bereiche sind optimal beziehungsweise akzeptabel, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.
Liegt das LDL-Cholesterin im Bereich von 116 bis unter 190 mg/dL (3,0 bis unter 4,9 mmol/L), ist es hoch normal bis hoch.
Ab 190 mg/dL (4,9 mmol/L) ist mit einem hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu rechnen. Zudem besteht der Verdacht, dass eine erbliche Stoffwechselstörung vorliegt.3
Non-HDL-Cholesterin
Das Non-HDL-Cholesterin umfasst alle im Gesamtcholesterin erfassten Cholesterine außer dem HDL-Cholesterin.
Vor allem bei erhöhten Triglyceriden ist das Non-HDL-Cholesterin zur Risikobewertung besser geeignet als das LDL-Cholesterin.
Dasselbe gilt bei Vorliegen einer genetischen Fettstoffwechselstörung, bei der die Verarbeitung von Fetten im Blut gestört ist. Diese Fettstoffwechselstörung wird in der medizinischen Fachsprache als Dysbetalipoproteinämie bezeichnet.
Nach den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (European Society of Cardiology, ESC) und der Europäischen Arteriosklerose Gesellschaft (European Atherosclerosis Society, EAS) von 2019 gelten folgende Zielwerte:
- 85 mg/dL (2,2 mmol/L) für Menschen mit sehr hohem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- 100 mg/dL (2,6 mmol/L) für Menschen mit hohem Risiko
- 130 mg/dL (3,4 mmol/L) für Menschen mit mittlerem Risiko
Grundsätzlich sind demnach Werte unter 130 mg/dL wünschenswert.3
HDL-Cholesterin
HDL steht für “high density lipoprotein”. Das HDL-Cholesterin hat die größte Dichte und hilft dabei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.
Werte von unter 40 mg/dL (unter 1,0 mmol/L) sind mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden.
Werte zwischen 40 und 69 mg/dL (1,0 bis unter 1,8 mmol/L) gelten als optimal, um das Herz-Kreislauf-System zu schützen.
Hohe HDL-Cholesterinwerte liegen im Bereich von 70 bis 89 mg/dL (1,8 bis unter 2,3 mmol/L) vor. Sie haben aber keinen zusätzlichen positiven Effekt.
Über 90 mg/dL (über 2,3 mmol/L) ist das Risiko für die Sterblichkeit möglicherweise erhöht.3
Triglyceride
Triglyceride gelten als wichtigste Energiereserve des Körpers.
Nüchternwerte unter 150 mg/dL beziehungsweise 1,7 mmol/L gelten als optimal.
Im Bereich von 150 bis 199 mg/dL (1,7 bis unter 2,3 mmol/L) sind die Triglyceride grenzwertig hoch und sollten durch eine Ernährungsumstellung und Bewegung gesenkt werden.
Bei Triglyceridwerten von 200 bis 879 mg/dL (2,3 bis unter 10,0 mmol/L) sollte bereits über eine medikamentöse Behandlung mit Lipidsenkern nachgedacht werden. Darüber gelten die Triglyceride als stark bis extrem erhöht.
Grundsätzlich sollten die Triglyceride immer im Zusammenhang mit allen anderen Blutfetten betrachtet werden.3
Lipoprotein (a)
Das Lipoprotein (a), kurz LP(a) hat einen ähnlichen Aufbau wie das LDL-Cholesterin.
Es wird ursächlich mit der Entstehung von Arteriosklerose in Verbindung gebracht und sollte mindestens einmal im Erwachsenenleben bestimmt werden.
LP(a)-Werte sollten bei gesunden Erwachsenen unter 75 nmol/L liegen.
Über 120 nmol/L ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen unabhängig von anderen Risikofaktoren erhöht.
LP(a) selbst kann man schwer gezielt senken. Daher sollten bei erhöhten LP(a)-Werten beeinflussbare Werte wie das LDL-Cholesterin gesenkt werden.3
Apolipoprotein B (ApoB-100)
Apolipoprotein B ist an der Ausscheidung cholesterinreicher Lipoproteine beteiligt. Es wird in der Leber gebildet und ist unter anderem maßgeblicher Proteinbestandteil des LDL-Cholesterins.
Erhöhte ApoB-100-Werte weisen auf ein erhöhtes Risiko für Arteriosklerose und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin.4
ApoB-100 kann alternativ zum LDL-Cholesterin eingesetzt werden, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzuschätzen. Der Referenzbereich liegt zwischen 0,65 und 1,20 g/L. Die Zielwerte liegen nach den ESC/EAS-Leitlinien 2019 bei:3
- unter 0,65 g/L für Personen mit sehr hohem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- unter 0,80 g/L für Menschen mit hohem Risiko
- unter 1,00 g/L für Personen mit einem mittleren Risiko
und
Verhältnis von ApoB-100 zu ApoA1
Der Referenzbereich für das Verhältnis von ApoB-100 zu ApoA1 liegt zwischen Werten von 0,35 bis unter 0,7.
Über 0,7 besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Über 1 ist das Risiko stark erhöht.3
Welche Arten von Fettstoffwechselstörungen gibt es?
Zum Fettstoffwechsel zählen verschiedene Blutfette, Lipoproteine und Apolipoproteine. Ist der Fettstoffwechsel gestört, kommt es zu einer übermäßigen Ansammlung dieser Biomoleküle im Blut.
Wann spricht man von einer Fettstoffwechselstörung?
Eine Fettstoffwechselstörung liegt vor, wenn ein oder mehrere Blutfette, Lipoproteine oder Apolipoproteine im Blut erhöht sind.5
Lipoproteine bestehen aus Fetten (Lipiden) und Eiweiß (Proteinen). Sie sind hauptsächlich für den Transport wasserunlöslicher Fette verantwortlich. Dazu zählen beispielsweise das Cholesterin und die Triglyceride.
Ein prominentes Beispiel ist das Lipoprotein (a), kurz Lp(a). Es besteht aus dem Apolipoprotein (a) und dem LDL(low densitiy lipoprotein)-Cholesterin. Apolipoproteine stellen also den Protein-Anteil der Lipoproteine dar.
Hohe Lp(a)-Blutwerte gelten als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie den Schlaganfall.
- erhöhtes LDL-Cholesterin
- erhöhtes LDL-Cholesterin in Kombination mit erhöhten Triglyceriden
- erhöhte Triglyceride
- niedriges HDL-Cholesterin
- erhöhtes LDL-Cholesterin und/oder erhöhte Triglyceride, begleitet von niedrigem HDL-Cholesterin
- erhöhtes Apolipoprotein B bei gleichzeitig normalen LDL-Cholesterinwerten
- erbliche Lipoproteinstörungen, wie familiär erhöhte Cholesterin- und/oder Triglyceridwerte
Wie erfolgreich eine Ernährungsumstellung oder lipidsenkende Medikamente die Blutfette senken können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel:
- Alter
- Körperbau
- Vererbung
- Umweltfaktoren
Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge von Fettstoffwechselstörungen
Erkrankungen der Halsschlagader wie die Karotisstenose entstehen zum Beispiel maßgeblich durch erhöhte Blutfette.5 Unser Herz-Kreislauf-System ist nicht in der Lage, frühe Stadien der Arteriosklerose zu erkennen und darauf zu reagieren. Dazu zählen Funktionsstörungen der Zellen, die die Blutgefäße auskleiden (Endothelzellen) und der glatten Muskelzellen, aber auch veränderte Stoffwechselaktivitäten in der Wand der Halsschlagader.
Die Verletzung der Halsschlagaderwand durch eine Funktionsstörung des Endothels führt dazu, dass weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten) sich an der Gefäßwand anlagern. Sie setzen Entzündungsbotenstoffe frei. Dadurch vermehrt sich die glatte Gefäßmuskulatur und es reichern sich Fette an.
Mit fortschreitender Arteriosklerose bilden sich sogenannte Plaques. Das sind verdickte Wandbereiche, die sich ins Gefäßinnere ausbreiten. Sie bestehen aus Fett, Zellen und faserigem Gewebe. Löst sich eine solche Plaque, kann sie als Blutgerinnsel mit dem Blutstrom beispielsweise in ein hirnversorgendes Gefäß gelangen.
Führt das Blutgerinnsel zum Verschluss dieses Gefäßes, kommt es zum Hirninfarkt. Gelangt ein solches Blutgerinnsel nach demselben Prinzip in ein Herzkranzgefäß und verschließt dieses vollständig, wird der Herzmuskel minderdurchblutet. Dadurch wird ein Herzinfarkt ausgelöst.
Wie kann man der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Fettstoffwechselstörungen entgegenwirken?
Die Umstellung der Ernährung kann zu einer Verbesserung der Fettstoffwechselstörung führen, die die erhöhten Blutfette verursacht. Stark erhöhte Blutfette werden mit lipidsenkenden Arzneimitteln aus der Gruppe der Statine behandelt.
Vor allem, wenn noch keine Gefäßveränderungen der Halsschlagader festgestellt werden, können auch Statine dem arteriosklerotischen Prozess im Frühstadium entgegenwirken. Diese werden jedoch häufig aufgrund befürchteter Nebenwirkungen sehr zögerlich eingesetzt. Bei sorgfältiger Auswahl des Statins ist die Anwendung allerdings sicher und schwerwiegende Nebenwirkungen können vermieden werden.5
Damit es gar nicht erst zur Notwendigkeit einer Behandlung mit Medikamenten kommt, ist eine Anpassung der Ernährung entscheidend. Vor allem der Verzehr von Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Insbesondere Omega-3-Fettsäuren haben sich als sehr wirksam für die Senkung der Blutfette erwiesen.
Zu Beginn einer Stoffwechselstörung ist es sinnvoll, den Verzehr von Fett im Allgemeinen zu reduzieren. Vor allem gesättigte Fette und Cholesterin sollten nur in Maßen verzehrt werden. Gleichzeitig sollte die Ernährung weniger einfache Zucker und stattdessen mehr komplexe Kohlenhydrate, beispielsweise in Form von Vollkornprodukten, enthalten. Die Menge an Protein kann üblicherweise beibehalten werden.5
Umstellung von ungesunden auf gesunde Fette in Ihrer Ernährung – So geht‘s leichter:
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Fette zu sich nehmen, als Ihr Körper benötigt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, durchschnittlich etwa 30 Prozent des täglichen Energiebedarfs mit Nahrungsfetten zu decken. Etwa 60 bis 80 Gramm Fett sind für Erwachsene mit geringer körperlicher Aktivität ein guter Richtwert.6
- Nehmen Sie dennoch ausreichend Fette zu sich. Fette sind nicht per se schlecht und Ihr Körper benötigt gute Fette, um seine gesunden Funktionen aufrechtzuerhalten.
- Reduzieren Sie, wenn möglich, den Verzehr von Transfetten auf ein Minimum. Das gelingt Ihnen, indem Sie selbst mit frischen Zutaten kochen.
- Meiden Sie Fertigprodukte, Fast Food und Produkte, in deren Inhaltsangaben Begriffe wie „teilgehärtet” oder „hydrogenisiert” stehen.
- Verzichten Sie möglichst auf frittierte Speisen und wählen Sie zum Braten hitzestabile Pflanzenöle, beispielsweise raffiniertes Rapsöl.6 Achten Sie darauf, das Öl nicht zu stark zu erhitzen. Es sollte keinesfalls anfangen zu rauchen.
- Schränken Sie den Verzehr gesättigter Fettsäuren ein. Schon der zurückhaltende Verzehr von rotem Fleisch und Vollmilchprodukten kann dazu beitragen.
- Solange das Verhältnis von gesättigten zu ungesättigten Fetten ausgewogen und der Fettkonsum insgesamt nicht zu hoch ist, spricht aber nichts gegen gesättigte Fettsäuren in Ihrer Ernährung. Etwa 20 bis 27 Gramm gesättigte Fettsäuren pro Tag sind nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei einer Kalorienzufuhr von 2000 kcal/Tag noch im Rahmen. Hundert Gramm Gouda (45% F. i. Tr.) enthalten bereits rund 18 Gramm gesättigte Fettsäuren. Zum Vergleich: Die gleiche Menge fettarmen Joghurts mit 1,5 bis 1,8 Prozent Fett enthält weniger als 1 Gramm gesättigte Fettsäuren.7
- Ersetzen Sie Transfette und gesättigte Fette durch ein- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sie können beispielsweise statt Butter Olivenöl zum Braten verwenden und sogar Ihr Brot darin dippen. Statt Chips mit einem hohen Anteil an Transfetten können Sie auf Nüsse jeglicher Art zurückgreifen.
- Wenn Sie nicht gänzlich auf Fleisch verzichten möchten, müssen Sie das auch nicht. Durch den Verzehr von Geflügelfleisch anstelle von rotem Fleisch können Sie effektiv den Konsum von gesättigten Fetten reduzieren.
Wann sollte eine Ernährungsumstellung erfolgen?
Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung mit überwiegend gesunden Fetten ist immer sinnvoll. Notwendig ist sie allerdings vor allem, wenn …
- Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, non-HDL-Cholesterin oder Triglyceride erhöht sind, beziehungsweise HDL-Cholesterin zu niedrig ist und die Ergebnisse 3 Wochen später in einer zweiten Bestimmung bestätigt werden,
- einer oder mehrere der Lipid- oder Lipoproteinwerte über dem erhöhten Grenzwert bleiben,
- eine Wiederholung des Lipoproteinprofils nach 6 bis 8 Wochen auf eine Fettstoffwechselstörung hindeutet.
Es ist wissenschaftlich belegt, dass etwa der tägliche Verzehr von 3 Portionen Margarine den LDL-Cholesterinwert um bis zu 10 bis 15 Prozent senken kann. Voraussetzung ist allerdings eine allgemein eher fettarme Ernährung.
Sojaprotein hingegen senkt unter anderem die Triglyceride und steigert das HDL-Cholesterin, hat aber keine Auswirkungen auf das LDL-Cholesterin.
Der tägliche Verzehr von 1 bis 2 Gramm Fischöl am Tag senkt die Triglyceride.5
Steigern oder senken Nahrungsfette in Milchprodukten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Milchprodukte liefern wichtige Nährstoffe und sind daher Bestandteil der Ernährung vieler Menschen. Mit steigendem Alter nimmt der Verzehr von Milch und Milchprodukten in der Regel ab.
Milch und Milchprodukte enthalten größere Mengen Nahrungsfett, Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Vor allem der Fettgehalt der Milch von Wiederkäuern wie der Kuh variiert stark. Er ist unter anderem abhängig von der Kuhrasse, der Jahreszeit und insbesondere vom Futter, mit dem die Kuh gefüttert wird.
Die Milch enthält zu einem großen Anteil gesättigte Fettsäuren, aber auch kleinere Mengen an ungesättigten Fettsäuren.
Die Fettzusammensetzung der Milch kann bewusst mit speziellem Futter für die Kühe positiv beeinflusst werden. Für die LDL-steigernde Wirkung von Fett aus der Milch von Wiederkäuern sind vor allem zwei gesättigte Milchsäuren verantwortlich: Myristinsäure und Palmitinsäure.5 Neben Milchprodukten finden sich diese beiden Fettsäuren vor allem auch in Kokosfett und Palmöl.
Die Studienlage ist nicht eindeutig. Während einige Studien darauf hindeuten, dass Milchprodukte das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, zeigen andere das genaue Gegenteil.
Konventionelle Milch wird aufgrund ihres hohen Gehalts an gesättigten Fettsäuren mit Fettstoffwechselstörungen in Verbindung gebracht. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass sie die Fähigkeit der Körperzellen, auf das blutzuckerregulierende Hormon Insulin zu reagieren, beeinträchtigt.
Milch enthält aber auch Ölsäure, eine einfach ungesättigte Fettsäure. Menschen, die viel Ölsäure über ihre Nahrung aufnehmen, profitieren von ihrer antiatherogenen Wirkung. Das bedeutet, dass sie der Ablagerung von Fett in den Wänden der Blutgefäße entgegenwirkt.
Somit verringert sie das Risiko der Verhärtung und Verengung der Arterien. Zudem gibt es auch Hinweise darauf, dass Milch den HDL-Cholesterinspiegel anhebt. Somit hat Milch nicht nur negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sondern auch positive.
Eine Studie zeigte, dass die Studienteilnehmer nach 4-wöchigem Verzehr von Milch mit veränderter Fettzusammensetzung niedrigere Triglyceride hatten.5
Hohe Triglyceride gelten als eigenständiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
In Deutschland stammen durchschnittlich etwa 30 Prozent des täglich aufgenommenen Gesamtfettes aus Milchfett.5 Daher ist es sinnvoll, die Milchfettzusammensetzung über das Futter der Wiederkäuer zu beeinflussen. Auf diese Weise kann die LDL-steigernde Wirkung des Milchfetts reduziert und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden.
Fettmodifizierte Milchprodukte und Milchalternativen
Wer gerne Milch und Milchprodukte in großen Mengen verzehrt, profitiert möglicherweise von Milchprodukten, deren Fettsäurezusammensetzung verbessert wurde.
Bio-Milch und Bio-Milchprodukte enthalten mehr einfach und mehrfach ungesättigte sowie weniger gesättigte Fettsäuren als konventionelle Milch. Auch Weidemilch hat ein günstigeres Fettsäureprofil.8
Viele Milchersatzprodukte, darunter Soja-, Hafer- und Mandeldrinks, weisen ebenfalls einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren auf. Sie sind hinsichtlich der Nahrungsfette eine gute Alternative zu tierischer Milch.
Nahrungsfette und ihre Rolle in der Entstehung von Krebs
Ein hoher Fettkonsum wird auch immer wieder mit der Entstehung verschiedener Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. Die Studienlage hierzu ist nicht eindeutig.9,10
Die Nurses Health Study II ergab beispielsweise, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, an Brustkrebs zu erkranken, vor allem von der Quelle abhängt, aus der die Fette stammen. Die Wahrscheinlichkeit war erhöht, wenn Frauen im Alter von 26 bis 44 Jahren große Mengen an tierischem Fett verzehrten. Nicht aber, wenn die Fette aus pflanzlichen Quellen stammten.9,11
Die Women’s Health Initiative untersuchte an fast 49.000 Frauen im Alter von 50 bis 79 Jahren die Auswirkungen von Fettkonsum auf die Entwicklung von Brustkrebs. Die Frauen wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: Die eine Gruppe ernährte sich wie gewohnt, die andere befolgte eine Diät mit deutlich niedrigerem Fettkonsum.
Die Studie konnte nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 8,1 Jahren keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Fettkonsum und der Anzahl aufgetretener Brustkrebserkrankungen feststellen.9,12
Auch weitere Studien konnten nicht belegen, dass durch einen höheren Fettkonsum das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen wie Brust-, Darm- oder Prostatakrebs steigt. Wohl aber gibt es Hinweise darauf, dass pflanzliche Fette gegenüber tierischen Fetten bevorzugt werden sollten.
Eine Ausnahme bildet scheinbar der Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten, da diese reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Männer, die große Mengen der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aus Meeresfrüchten zu sich nahmen, entwickelten mit geringerer Wahrscheinlichkeit Prostatakrebs. Das zeigte unter anderem die Health Professionals Follow-up-Studie.9
Ist es sinnvoll, zugunsten der Gesundheit auf Fett zu verzichten?
Nein. Auf Fett gänzlich zu verzichten, ist absolut nicht sinnvoll. Ganz im Gegenteil: Auf diese Weise können wir unserer Gesundheit schaden. Der menschliche Körper ist auf Fett angewiesen. Manche Fette kann er selbst herstellen, einige jedoch nicht. Darum gehören zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung auch Fette.
Entscheidend ist die Art der Fette und in welchen Mengen wir sie verzehren. Denn es gibt durchaus Fette, die man meiden oder in geringerem Maße zu sich nehmen sollte: die industriell erzeugten Transfette und die gesättigten Fette.9 Es geht also vielmehr darum, die Fette, die unserer Gesundheit eher schaden, durch Fette zu ersetzen, die positive Effekte auf unsere Gesundheit haben.
Wichtig ist aber auch, die Gesamtmenge an Fett dadurch nicht zu steigern. Denn überschüssiges, mit der Nahrung aufgenommenes Fett - egal, ob gut oder schlecht - führt zu einer Gewichtszunahme.
Chemie der Fettsäuren
Wie unterscheiden sich Fettsäuren?
Fettsäuren bestehen nur aus drei Elementen und sind zu langen Ketten angeordnet. Doch es gibt drei chemische Kriterien, anhand derer sie sich voneinander unterscheiden:9
- Anzahl der Kohlenstoffatome (meist gerade Anzahlen)
- Art der Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen (Einfach- oder Doppelbindung)
- räumliche Anordnung der Kohlenstoffkette (gerade oder gebogen)
Woher kommt die Bezeichnung “gesättigt” oder “ungesättigt”?
Eine Fettsäure gilt als “gesättigt”, wenn alle Kohlenstoffatome der Fettsäurekette die maximale Anzahl an Wasserstoffatomen gebunden haben, die sie binden können. Sie sind gesättigt.
Einzelne Kohlenstoffatome der Kette können keine Doppelbindung zu ihrem benachbarten Kohlenstoff eingehen. Alle Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen sind demnach Einzelbindungen. Die Fettsäurekette sieht wie eine gerade Linie aus.
Bei den ungesättigten Fettsäuren liegen zwischen einzelnen Kohlenstoffatomen eine (einfach ungesättigte) oder mehrere (mehrfach ungesättigte) Doppelbindungen vor. Dadurch können sie weniger Wasserstoffatome binden.
Die Kette ist nicht mehr gerade, sondern bildet eine gebogene Struktur. Dadurch sind ungesättigte Fette bei Raumtemperatur flüssig. Über die Doppelbindungen können ungesättigte Fettsäuren mit anderen Stoffen im Körper reagieren. Sie sind daher “ungesättigt”.
Ungesättigte Fettsäuren
Ungesättigte Fettsäuren kommen vor allem in pflanzlichen und tierischen Ölen vor. Auch in fetten Fischarten oder Samen und Nüssen sind große Mengen ungesättigter Fettsäuren enthalten.
Für ihre flüssige Form sind die Doppelbindungen in ihrer Molekülstruktur verantwortlich. Durch diese wird der Schmelzpunkt der Fettsäure gesenkt.
Die Doppelbindungen in natürlichen Fettsäuren haben meist die sogenannte Cis-Konfiguration.
Was ist eine Cis-Konfiguration?
Die Kettenstruktur der Fettsäure wird durch mehrere Kohlenstoffatome gebildet, die miteinander verknüpft sind. An den Kohlenstoffatomen können jeweils weitere Atome gebunden sein.
Bei den ungesättigten Fettsäuren sind jeweils zwei Kohlenstoffatome der Kette an bestimmten Positionen durch eine Doppelbindung miteinander verknüpft. Die weiteren Atome, die an diese zwei Kohlenstoffatome gebunden sind, befinden sich auf derselben Seite der Doppelbindung.
Das Gegenteil ist bei der Trans-Konfiguration der Fall: Hier befinden sich die anderen Atome auf den entgegengesetzten Seiten der Doppelbindung.

Cis- und Trans-Konfiguration der Doppelbindung ungesättigter Fettsäuren. Bei der Cis-Anordnung befinden sich die an die Kohlenstoffatome gebundenen weiteren Atome auf derselben Seite der Doppelbindung.Bei der Trans-Anordnung befinden sie sich auf den entgegengesetzten Seiten der Doppelbindung.
Einfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-9-Fettsäuren)
Einfach ungesättigte Omega-9-Fettäuren enthalten in ihrer chemischen Struktur eine Doppelbindung. Doppelbindungen beeinflussen die Eigenschaften der Fettsäuren. Durch die Doppelbindung ist die Fettsäure flüssiger, weil der Schmelzpunkt herabgesetzt wird. Die wohl bekannteste Omega-9-Fettsäure ist die Ölsäure.13
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren)
Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren Omega-3 und Omega-6 enthalten zwei oder mehr Doppelbindungen. Dadurch ist der Schmelzpunkt noch niedriger als der von einfach ungesättigten Fettsäuren.
Manche mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind essentiell. Das heißt, dass unser Körper sie nicht selbst herstellen kann. Daher müssen diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren über die Nahrung aufgenommen werden.
Mit jeder Doppelbindung mehr wird die Fettsäure “reaktionsfreudiger”. Das heißt, sie geht einfacher Bindungen zu anderen Molekülen ein und kann vielfältiger im Stoffwechsel verwertet werden.
Die Anzahl und Position der Doppelbindungen entscheiden darüber, welcher Gruppe die mehrfach ungesättigten Fettsäuren zugeordnet werden: den Omega-3- oder den Omega-6-Fettsäuren.
Die erste Doppelbindung der Omega-3-Fettsäuren befindet sich zwischen dem dritten und vierten Kohlenstoffatom der Fettsäurekette. Bei den Omega-6-Fettsäuren besteht die erste Doppelbindung zwischen dem sechsten und siebten Kohlenstoffatom.14
Trans-Fettsäuren
Trans-Fettsäuren sind eine Art Sonderform der ungesättigten Fettsäuren. Die an die mit einer Doppelbindung verknüpften Kohlenstoffatome gebundenen anderen Atome befinden sich in der sogenannten Trans-Konfiguration. Sie liegen also auf entgegengesetzten Seiten der Doppelbindung.
Trans-Fettsäuren kommen natürlich vor, entstehen aber vor allem als Nebenprodukt industrieller Verarbeitungsprozesse. Dazu zählt die Härtung von pflanzlichen Ölen zur Herstellung von Margarine. Zudem entstehen sie beim Erhitzen von Pflanzenölen auf hohe Temperaturen (über 200 Grad Celsius). Natürlich kommen sie in Milchprodukten und Fleisch von Wiederkäuern vor.15
Gesättigte Fettsäuren
In der Kettenstruktur der gesättigten Fettsäuren kommen keine Doppelbindungen vor. Die Kohlenstoffatome der Kette sind nur über Einfachbindungen verknüpft. Sie sind daher im Gegensatz zu den ungesättigten Fettsäuren eher “reaktionsträge” und ihr Schmelzpunkt liegt höher. Das bedeutet, dass sie bei Raumtemperatur in der Regel in fester Form vorliegen.
Beispiele für tierische Lebensmittel mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren sind Butter und Käse. Aber auch pflanzliche Fette wie beispielsweise Kokos- oder Palmfett enthalten viele gesättigte Fettsäuren.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Welche Fette sind gesund?
- Gemeinsame Risikofaktoren für Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Risiko-Vorhersage für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
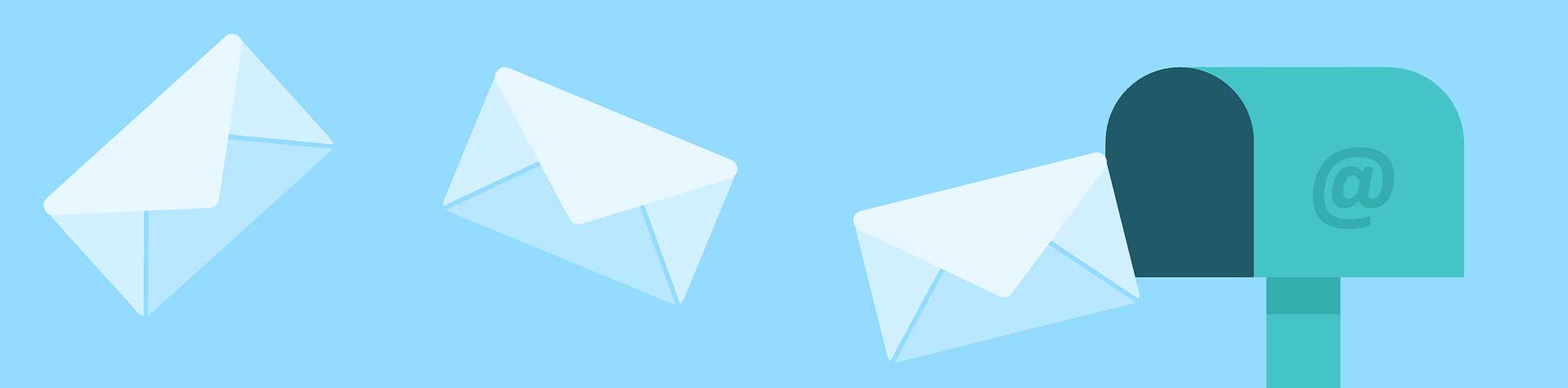
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autoren
Dipl.-Biol. Claudia Helbig unter Mitarbeit von Prof. Dr. med. Hans Joachim von Büdingen
Claudia Helbig ist Diplom-Human- und Molekularbiologin und hat zuvor eine Ausbildung zur Arzthelferin absolviert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Medizinischen Biochemie und Molekularbiologie hat sie Medizinstudenten in Pathobiochemie-Seminaren und Praktika betreut. Nach Ihrer Arbeit in der pharmazeutischen Forschung hat sie in einem Auftragsforschungsinstitut für klinische Studien unter anderem Visiten mit Studienteilnehmern zur Erhebung von Studiendaten durchgeführt und Texte für die Website verfasst. Mit ihrem interdisziplinären Hintergrund und ihrer Leidenschaft zu schreiben möchte sie naturwissenschaftliche Inhalte fachlich fundiert, empathisch und verständlich an Interessierte vermitteln. [mehr]
Quellen
- Energie; Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE); (abgerufen am 26.05.2025) - Publikation: - URL: https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/energie/
- 13 Umsetzung der Leitlinie (Umsetzung der DGE-Leitlinie Fett 2015); Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE); (erstellt 2015; abgerufen am 27.05.2025 - URL: https://www.dge.de/fileadmin/dok/wissenschaft/leitlinien/fette/13-Umsetzung-DGE-Leitlinie-Fett-2015.pdf
- Klinikleitfaden Labordiagnostik (2024), 8. Auflage - Autoren: Bernhard O. Böhm; Christoph Niederau; Matthias Peter Aymanns - Publikation: Elsevier Verlag; München - ISBN: 978-3-437-05604-8; 978-3-437-21094-5
- Hyperlipidaemia Autoren: Penny M. Kris-Etherton; Lisa Sanders; Olivia Lawler; Terrence Riley; Kevin Maki Publikation: Encyclopedia of Human Nutrition (Fourth Edition) 2023, Pages 361-379 - ISBN: 978-0-323-90816-0
- Modern dietary fat intakes in disease promotion (2010); Nutrition and Health Autoren: Fabien De Meester; Sherma Zibadi; Ronald R. Watson Publikation: Humana Press New York, 2010 ISBN: 978-1-60327-570-5; 978-1-60327-571-2
- Fett in der Ernährung: Fakten rund um die Bedeutung von Fett für den Körper; Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE); (erstellt 2023; abgerufen am 04.06.2025) - URL: https://www.dge.de/blog/2023/fett-in-der-ernaehrung-fakten-rund-um-die-bedeutung-von-fett-fuer-den-koerper/
- Gesättigte Fettsäuren (SFA) – Lebensmittel; Dr. Gehring Vitalstoffe GmbH & Co. KG (abgerufen am 05.06.2025) - URL: https://www.eucell.de/ernaehrung/lebensmittellisten/makro-und-mikronaehrstoffgehalt/fettsaeuren/gesaettigte-fettsaeuren-sfa
- Ernährungsphysiologische Bewertung von Milch und Milchprodukten und ihren Inhaltsstoffen; Max-Rubner-Institut (MRI); (erstellt im November 2014; abgerufen am 05.06.2025) - URL: https://www.mri.bund.de/fileadmin/MRI/News/Dateien/Ernährungsphysiolog-Bewertung-Milch-Milchprodukte.pdf
- Harvard Medical School Guide Gesunde Ernährung: Einfach und praktisch: erstklassige Wissenschaft für Ihre tägliche Ernährung. Der Bestseller aus den USA; 1. Auflage (2022) - Autoren: Walter C. Willett; Patrick J. Skerrett; Benjamin Schilling; Ralf Pannowitsch - Publikation: TRIAS Verlag; Stuttgart, 2022 - ISBN: 978-3-432-11450-7; 978-3-432-11451-4
- The Association Between Different Kinds of Fat Intake and Breast Cancer Risk in Women - Autoren: Mahdieh Khodarahmi; Leila Azadbakht - Publikation: Int J Prev Med. 2014;5(1):6-15 - PMID: 24554986
- Premenopausal Fat Intake and Risk of Breast Cancer - Autoren: E. Cho; D. Spiegelman; D. J. Hunter; W. Y. Chen; M. J. Stampfer; G. A. Colditz; W. C. Willett - Publikation: National Cancer Institute, Volume 95, Issue 14, 16 July 2003, Pages 1079–1085 - DOI: 10.1093/jnci/95.14.1079
- Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Invasive Breast Cancer: The Women's Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial - Autoren: Ross L. Prentice; Bette Caan; Rowan T. Chlebowski; Ruth Patterson; Lewis H. Kuller; et al. - Publikation: JAMA. 2006;295(6):629–642 - DOI: 10.1001/jama.295.6.629
- Die Omega-Familie: Omega 3 / 6 / 9 Fettsäuren; Pronova BKK; (abgerufen am 28.05.2025) - URL: https://www.pronovabkk.de/gesuender-leben/ernaehrung/gesuender-essen/omega-3-6-9-fettsaeuren.html
- The omega-6/omega-3 fatty acid ratio: health implications - Autorin: Artemis P. Simopoulos - Publikation: Oléagineux, Corps gras, Lipides; Volume 17, Number 5, Septembre-Octobre 2010; pages 267-275 - DOI: 10.1051/ocl.2010.0325
- Trans-Fettsäuren in Lebensmitteln; Niedersächsisches Landesamt für Verbaucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES); (heruntergeladen am 28.05.2025) URL: https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/lebensmittel/lebensmittelgruppen/ole_fette/trans-fettsauren-in-lebensmitteln-188311.html


