Fazialisparese (Gesichtslähmung) ▷ Symptome, Formen, Behandlung

Fazialisparese bei betroffener linken Seite
In diesem Artikel:
- Symptome einer Fazialisparese
- Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer peripheren Fazialisparese?
- Zentrale Fazialisparese
- Periphere Fazialisparese
- Die idiopathische Fazialisparese
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Fazialisparese (Gesichtslähmung) ist eine Funktionsstörung des Nervus facialis. Als siebter Hirnnerv ist er überwiegend für die Aktivierung der mimischen Gesichtsmuskulatur zuständig. Über ihn gelangen die Nervenimpulse von der Zentrale im Gehirn zu den Muskeln des Gesichts.
- Verursacht wird eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur durch die Schädigung von Nervenbahnen.
- Abhängig vom Ort der Schädigung unterscheidet man zwischen einer zentralen oder peripheren Fazialisparese.
- Die häufigste periphere Fazialisparese ist die Idiopathische Fazialisparese. Ihre Ursache ist nicht bekannt.
- Obwohl die periphere Fazialisparese keine bedrohliche Erkrankung ist, bedeutet sie für Betroffene häufig eine schwere Beeinträchtigung. Auch aus kosmetischen Gründen.
- Häufigste Ursache einer zentralen Fazialisparese ist der Schlaganfall. Auffälligstes Symptom ist das Herabhängen eines Mundwinkels als wichtiges Zeichen auch zur Feststellung eines Schlaganfalls (siehe FAST-Test).
Anatomische Grundlagen
Der Nervus facialis wird auch als siebter Hirnnerv bezeichnet. Seine Ursprungszellen (motorischer Kern) hat er beiderseits im Hirnstamm.
Von dort aus ziehen die Nervenfasern im Kleinhirnbrückenwinkel an der Schädelbasis mit dem achten Hirnnerv (Nervus statoacusticus) zunächst in den inneren Gehörgang. Dann durch den 3 cm langen Knochenkanal (Canalis facialis, Fazialiskanal) im Felsenbein des Schädels.
Danach tritt er durch ein Loch im Schädel (Foramen stylomastoideum) unterhalb des Ohres aus und verzweigt sich in seine Äste. Sie regen einzelne Abschnitte der Gesichtsmuskulatur durch Nervenimpulse an. So ist der Stirnast beispielsweise für die Muskulatur der Stirn oder der Mundast für die Muskulatur der Wangen und des Mundes zuständig.
Dieser Online-Ratgeber unterstützt Sie bei allem, was jetzt zu tun ist.
Die Kernzellen des Nervus facialis im Hirnstamm werden von Nervenbahnen angeregt. Sie haben ihren Ursprung im Großhirn und ziehen als Pyramidenbahn zum Hirnstamm und Rückenmark.
Das Großhirn ist also der Dirigent für alle willkürlichen Bewegungen und somit auch für die Muskulatur des Gesichts.
Neben den Nervenfasern für die Muskulatur enthält der Nervus facialis im Canalis facialis weitere Fasern:
- gustatorische für die Geschmacksempfindung der vorderen zwei Drittel der Zunge
- sekretorische für Tränen-, Schleim- und Speicheldrüsen.
Im Canalis facialis gehen auch Fasern für den Steigbügelmuskel (Musculus stapedius) ab. Dieser ist im Mittelohr an der Schallweiterleitung beteiligt.
Der Nervus facialis hat also viele Funktionen. Sie erklären die vielfältigen Symptome, die durch eine Schädigung dieses Nervs auftreten können.
Symptome einer Fazialisparese
Das offensichtlichste Symptom ist die Lähmung von Muskeln einer Hälfte des Gesichts.
Besonders auffällig bei der Betrachtung einer einseitigen peripheren Fazialisparese ist die Asymmetrie des Gesichts.
- Die Stirn ist auf der betroffenen, gelähmten Seite glatter, die Falten sind verstrichen.
- Die Ausdrucksbewegungen (Mimik) einer Gesichtsseite sind deutlich reduziert oder aufgehoben.
- Auch die Falte zwischen Nase und Wange ist verstrichen.
- Die Lidspalte ist weiter.
- Die Augenbraue steht tiefer.
- Die Mittellinie des Mundes ist zur nicht betroffenen Seite verzogen.
- Der Mundwinkel steht tiefer. Er hängt herab.
Eingeschränkte Fähigkeiten und weitere Symptome auf der betroffenen Seite:
- Nach Aufforderung, die Augenbrauen hochzuziehen und die Stirn zu runzeln, gelingt dies nur auf einer Seite.
- Sollen die Zähne gezeigt werden, verzieht sich der Mund zur intakten Seite. Das Essen ist erschwert, da sich Anteile der Speise zwischen der oberen Zahnreihe und der Wange festsetzen können.
- Der Augenschluss ist auf der gelähmten Seite unvollständig. Das Auge verdreht sich nach oben außen. Bei einer kompletten Lähmung der Muskulatur um das Auge besteht die Gefahr einer Hornhautschädigung.
- Das Auge auf der betroffenen Seite tränt.
- Beim Aufblasen des Mundes entweicht die Luft auf der betroffenen Seite. Pfeifen gelingt nicht. Der Mund verzieht sich zur gesunden Seite.
- Aus der gelähmten Mundseite kann Speichel tropfen.
- Auch das Sprechen ist verändert und klingt leicht verwaschen.
- Geräusche können auf der betroffenen Seite überlaut und scheppernd wahrgenommen werden. Dies wird als Hyperakusis bezeichnet.
- Geschmacksstörungen (Schmeckstörungen) können vorkommen.
Deutlicher werden diese Veränderungen beim Sprechen oder Lachen.
Beiderseitige Fazialisparesen sind sehr selten. Treten sie aber auf, äußern sie sich durch folgende Symptome:
- Das Gesicht erscheint starr und unbeweglich wie eine Maske.
- Der Mund ist leicht geöffnet. Speichel fließt heraus.
- Mimische Ausdrucksbewegungen wie Lachen oder Weinen sind nicht möglich.
- Das Sprechen ist erschwert.
Untersuchung einer Fazialisparese
Zunächst wird die Gesichtsmuskulatur untersucht. Die erste Aufforderung ist, die Stirn zu runzeln, dann die Augen zu schließen. Dabei fällt auf, dass die Augenbraue nicht gehoben und das Auge auf der gelähmten Seite nicht geschlossen werden kann. Bei der Aufforderung, den Mund zu spitzen oder die Zähne zu zeigen, wird die Lähmung der Mundmuskulatur deutlicher.
Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer peripheren Fazialisparese?
Zunächst unterscheiden sie sich anhand des anatomischen Ortes der Schädigung.
Durch einen Schlaganfall oder einen Hirntumor können zum Beispiel Nervenzellen oder Nervenbahnen im Gehirn geschädigt werden, die für die Anregung des Nervus facialis im Hirnstamm verantwortlich sind. In diesem Fall spricht man von einer zentralen Fazialisparese.
Werden die Kernzellen des Nervus facialis im Hirnstamm oder der Nerv in seinem weiteren Verlauf bis zur Gesichtsmuskulatur geschädigt, ist eine periphere Fazialisparese die Folge.
Die zentrale und periphere Fazialisparese unterscheiden sich in ihren Symptomen durch folgende Merkmale:
- Bei der zentralen Parese ist der Stirnast kaum betroffen. Die Stirn kann also gerunzelt und das Auge kann gelegentlich leicht abgeschwächt geschlossen werden. Hauptmerkmal ist der hängende Mundwinkel.
- Bei der peripheren Parese kann die Stirn nicht gerunzelt und das Auge nicht geschlossen werden. Beim Versuch, das Auge zu schließen, verdreht es sich nach oben. Zudem kann eine Überempfindlichkeit für Geräusche (Hyperakusis) auftreten. Oft zeigt sich das beim Telefonieren. Auch Geschmacksstörungen und verminderte Tränensekretion sind möglich.
Zentrale Fazialisparese (Gesichtslähmung vom zentralen Typ)
Innerhalb des Gehirns kann es zu einer Schädigung von Nervenzellen oder Nervenbahnen kommen, die für die Aktivierung des Nervus facialis verantwortlich sind. Die daraus resultierende Gesichtslähmung wird als zentrale Fazialisparese bezeichnet.
Was sind die Ursachen einer zentralen Fazialisparese?
- ischämischer Schlaganfall (Hirninfarkt) als häufigste Ursache
- seltener eine Hirnblutung
- Tumore im Schädel, innerhalb oder außerhalb des Gehirns, zum Beispiel von der Hirnhaut ausgehend (Meningeom)
Hirnverletzungen - entzündliche Erkrankungen des Gehirns
Periphere Fazialisparese (Gesichtslähmung vom peripheren Typ)
Die periphere Fazialisparese (auch Bell’s Palsy genannt) ist die häufigste Erkrankung eines Hirnnerven und tritt überwiegend einseitig auf.
Sie entsteht durch eine Schädigung des Nervus facialis in seinem Verlauf vom Kerngebiet im Hirnstamm bis zu seinen Zielorganen. Zu den Zielorganen gehören:
- die mimische Muskulatur des Gesichts
- die Geschmacksknospen der vorderen Zunge
- die Drüsen für die Tränen- und Speichelproduktion
- der Steigbügelmuskel im Mittelohr.
Bei Läsionen im Bereich des Hirnstamms und vor Eintritt des Nerven in den Fazialiskanal des Felsenbeins ist die Lähmung (Parese) rein motorisch. Es ist dann ausschließlich die Gesichtsmuskulatur betroffen.
Im Fazialiskanal ist der Nerv durch entzündliche Nervenauftreibungen besonders gefährdet. Bei einer Läsion in diesem Kanal sind meistens auch die Fasern für Geschmack und für Tränen- und Speicheldrüsen mitbetroffen. Zudem kann es zu einer Lähmung des Steigbügelmuskels mit Hörstörung (Hyperakusis) kommen.
Obwohl die periphere Fazialisparese keine bedrohliche Erkrankung ist, bedeutet sie für Betroffene häufig eine schwere Beeinträchtigung. Auch aus kosmetischen Gründen.
Die idiopathische Fazialisparese
In den meisten Fällen (60 - 75 Prozent) kann die Ursache (Ätiologie) einer peripheren Fazialisparese nicht eindeutig geklärt werden. Man spricht dann von einer idiopathischen Fazialisparese.
Von dieser sind jährlich 7 - 40 Patientinnen und Patienten/100.000 Personen betroffen. Sie kommt mit zunehmendem Alter etwa gleich häufig bei Frauen und Männern vor.
Die Symptome können sehr vielfältig und unterschiedlich sein. Oft klagen Betroffene mit Auftreten der Fazialisparese über Schmerzen in der Region hinter dem Ohr (retroaurikulär).
Auch Missempfindungen im Bereich der Wange können vorkommen. Geschmacksstörungen oder Hörstörungen sind seltener. Ein trockener Mund wird als Hinweis auf eine schwere Fazialisparese gesehen.
Nicht selten geht ein unspezifischer Infekt voraus. Vermutet wird in den meisten Fällen ein Virusinfekt, wie das Wiederauftreten einer Herpes-simplex-Infektion. Hierbei kommt es zu einer Entzündung des Nervs mit Schwellung (Ödem), was zur Druckschädigung des Nervs im Fazialiskanal beiträgt.
Was sind Ursachen einer peripheren, nicht idiopathischen Fazialisparese?
Bei etwa einem Drittel der Menschen mit peripherer Fazialisparese kann die Ursache (Ätiologie) erkannt werden.
Ursachen sind:
- Infektionen zum Beispiel im Rahmen einer Borreliose, Tuberkulose, Syphilis, HIV oder unterschiedliche virale Erreger wie der Herpes Zoster
- gutartige und bösartige Tumoren, auch Metastasen im Bereich der Schädelbasis, des Nerven selbst, der Ohrspeicheldrüse und an anderer Stelle
- Verletzungen (traumatisch) zum Beispiel durch einen Bruch (Fraktur) des Felsenbeins, in dem der knöcherne Kanal des Nervus facialis verläuft
- Autoimmunerkrankungen wie die Multiple Sklerose oder eine immunvermittelte Entzündung von Nerven und Nervenwurzeln (Guillain-Barre-Syndrom)
- Diabetes mellitus
Prognose der idiopathischen Fazialisparese
Insgesamt ist die Prognose günstig. Bei unbehandelten Betroffenen1 kommt es innerhalb von drei Wochen nach Erkrankungsbeginn in ca. 85 Prozent zu einer Rückbildung der Symptome. Wenn die Besserung der Symptome unvollständig ist, kann es zu Folgen kommen, die nachstehend beschrieben werden.
Folgen der peripheren Fazialisparese
Die periphere, idiopathische Fazialisparese heilt meistens ohne Folgen aus. Ist die Heilung nicht vollständig, kann es zu typischen Störungen kommen.
Beispiele sind:
- Besonders auffällig sind Mitbewegungen (Synkinesien). Bei Augenschluss kommt es unwillkürlich zum Anheben des Mundwinkels der gleichen Seite. Oder umgekehrt: Beim Blinzeln hebt sich der Mundwinkel.
- Verkürzungen (Kontrakturen) von Gesichtsmuskeln bewirken eine enge Lidspalte, eine ausgeprägte Falte zwischen Wange und Nase oder einen hochgezogenen Mundwinkel. Hierdurch kann eine entstellende Asymmetrie des Gesichts entstehen.
- Beim Essen kann ein spontaner Tränenfluss durch Anregung der Speicheldrüsen ausgelöst werden.
Therapie der peripheren Fazialisparese
Medikamentöse Behandlung
Zu empfehlen ist die Behandlung mit dem Glukokortikoid Prednisolon in Tablettenform. Hierdurch wird die Heilung in vielen Fällen beschleunigt und Folgeerscheinungen wie unwillkürliche Muskelzuckungen der Gesichtsmuskulatur werden vermieden.2
Die gleichzeitige Behandlung mit einem Virostatikum, also einem Viren abtötenden Medikament, ist umstritten und nur in Ausnahmefällen zu empfehlen.
Nicht medikamentöse Behandlung
Im Vordergrund stehen Maßnahmen zum Schutz der Hornhaut des Auges der betroffenen Seite bei unzureichendem Lidschlag. Es besteht die Gefahr der Austrocknung und Entzündung der Hornhaut. Hilfreich sind künstliche Tränen, spezielle Salben und ein Uhrglasverband, zumindest während der Nacht.
Übungsbehandlung
Einen eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis zur Wirksamkeit von Bewegungsübungen gibt es bisher nicht. Dennoch sollte die physiotherapeutische Übungsbehandlung schon nach Auftreten der ersten Symptome eingeleitet werden. Nach kurzer Anleitung können die Übungen dann vor dem Spiegel durchgeführt werden.
Leitlinie „Idiopathische Fazialisparese“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie e. V.
Die wichtigsten Empfehlungen dieser Leitlinie vom 28.02.2022 sind:
- Die medikamentöse Behandlung der idiopathischen Fazialisparese soll mit dem Glukokortikoid Prednisolon erfolgen. Sie begünstigt die vollständige Rückbildung und verringert das Risiko von Folgeerscheinungen.
- Bei schwer Betroffenen kann im Einzelfall eine gegen Viren gerichtete (virostatische) Therapie nützlich sein.
- Maßnahmen zum Schutz der Hornhaut sind bei fehlendem Lidschluss besonders wichtig.
- Bei anhaltenden Paresen können auch chirurgische Eingriffe erwogen werden.
- Eine in der Schwangerschaft oder im Wochenbett auftretende idiopathische Fazialisparese sollte nach den oben genannten Grundsätzen behandelt werden. Die Prednisolontherapie sollte stationär erfolgen.
- Obwohl der Nutzen einer Übungsbehandlung bisher wissenschaftlich nicht eindeutig nachgewiesen ist, kann sie auch aus psychologischen Gründen in Betracht gezogen und empfohlen werden.
- 25-40 Prozent der peripheren Fazialisparesen sind nicht idiopathisch, also ursächlich nicht erklärbar. Bei der Vielzahl möglicher Ursachen sind weitergehende Untersuchungen wie die Kernspintomographie, Untersuchung des Nervenwassers nach Lumbalpunktion oder Borrelien-Serologie notwendig.
Medizinische Fachgebiete, welche sich mit der Diagnostik und Behandlung einer peripheren Fazialisparese befassen, sind neben der Allgemeinmedizin die Neurologie, die Radiologie, die Augenheilkunde und die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Die Folgen des Schlaganfalls
- Was ist ein Schlaganfall?
- Hemianopsie (Halbseitenblindheit)
- Lähmung (Hemiparese)
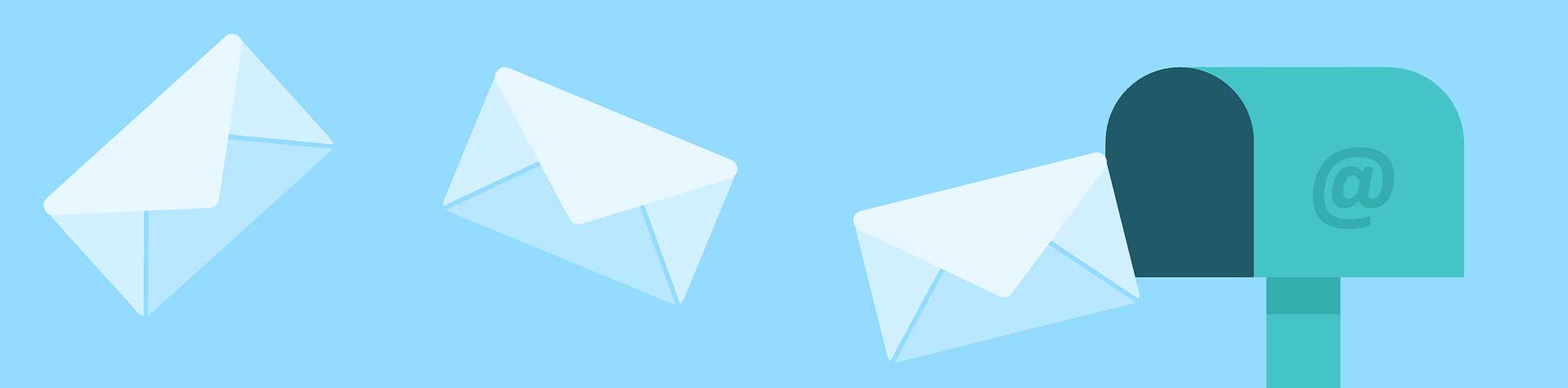
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Dieser Online-Ratgeber unterstützt Sie bei allem, was jetzt zu tun ist.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autor
Prof. Dr. med. Hans Joachim von Büdingen ist niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie am Neurozentrum Ravensburg. Als Chefarzt leitete er die Abteilung für Neurologie und Klinische Neurophysiologie am Krankenhaus St. Elisabeth in Ravensburg. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gehört die Diagnostik und Behandlung von Schlaganfällen. [mehr]
Quellen
- The natural history of Bell’s palsy - Autor: Peitersen E. - Publikation: Am J Otol 1982; 4: 107-111.
- Corticosteroids for Bell's palsy (idiopathic facial paralysis) - Autoren: R A Salinas, G Alvarez, J Ferreira - Publikation: Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 18:(4):CD001942. - DOI: 10.1002/14651858.cd001942.pub2
- Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Leitlinie “Idiopathische Fazialisparese” 2022


