Sterben nach einem Schlaganfall ▷ Was, wenn trotz aller Therapien ein lebenswertes Leben nicht mehr möglich ist?

Bei einer Palliativtherapie werden Beschwerden gelindert, Schmerzen und Atemnot genommen und das Sterben zugelassen (Foto: Mr.songkod Sataratpayoon | Shutterstock)
Das Wichtigste in Kürze:
- Auch wenn sich die Prognose nach einem Schlaganfall verbessert hat, ist der Tod an den Folgen eines Schlaganfalls keine Seltenheit.
- Eine Patientenverfügung oder Gespräche über das Sterben und die eigenen Wünsche am Lebensende helfen Behandlern und Angehörigen, in einer schwierigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.
- Die Begrenzung oder Beendigung einer lebensverlängernden Therapie kann die richtige und notwendige Entscheidung sein.
- Bei einer Palliativtherapie werden Beschwerden gelindert, Schmerzen und Atemnot genommen und das Sterben zugelassen.
- Offene Gespräche, gute Kommunikation und rechtzeitige Entscheidungen ermöglichen ein Sterben in Würde und ohne Schmerzen.
Schlagartig ist alles anders
Ein Schlaganfall kommt wie aus dem Nichts. Wie der Name schon sagt, treten die Beschwerden plötzlich, wie aus heiterem Himmel, auf. Entsprechend schwierig ist es, sich auf das vorzubereiten, was passiert oder passieren soll, wenn man selbst einen Schlaganfall erleidet.
Zunächst muss alles so schnell wie möglich gehen. Der Rettungsdienst wird gerufen und der Patient so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht, um eine frühzeitige Akutversorgung durch Thrombolyse, Thrombektomie und Behandlung auf einer spezialisierten Schlaganfallstation zu ermöglichen.
Die Möglichkeiten der Akutbehandlung haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm verbessert, so dass die Folgen eines Schlaganfalls für immer mehr Patienten gemildert werden können. Entsprechend hat sich auch die Prognose für die Lebenserwartung nach einem Schlaganfall verbessert.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Nach aktuellen Zahlen überleben 93 Prozent der Patienten den ersten Monat nach einem Schlaganfall.1 Einflussfaktoren auf die Prognose sind vor allem das Alter der Betroffenen (jüngere Patienten haben eine deutlich geringere Sterblichkeit als ältere), die Art des Schlaganfalls und das Ausmaß der Hirnschädigung.2
Sterblichkeit nach Schlaganfall
Die Erfolge in der Schlaganfallbehandlung dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer noch ca. 7 Prozent aller Betroffenen innerhalb des ersten Monats nach einem Schlaganfall an den Folgen sterben.
Diese Zahlen beziehen sich auf alle Formen des Schlaganfalls. Sie beinhalten also auch so genannte “minor strokes”, die nur ein kleines Hirnareal betreffen und zu geringen Einschränkungen führen. Diese kleineren Schlaganfälle können zu Einschränkungen im Alltag und damit auch zu großem Leid führen, sind aber mit einer geringen Sterblichkeit verbunden.
Andere Formen des Schlaganfalls, wie die spontane Hirnblutung, gehen mit einer deutlich höheren Sterblichkeit von ca. 25 Prozent einher.3
Der Tod ist unausweichlich
Diese Zahlen zeigen, dass der Tod kurz nach einem Schlaganfall keine Seltenheit ist. Daran werden auch weitere Verbesserungen in der Therapie nichts Grundlegendes ändern.
Ein Schlaganfall tritt überproportional häufig auf, wenn gleichzeitig andere schwere Grunderkrankungen wie koronare Herzkrankheit oder Krebs vorliegen. Manchmal ist die Kombination der verschiedenen Erkrankungen nicht mit dem Leben vereinbar.
Das Gehirn reagiert sehr empfindlich auf eine Unterversorgung mit Blut und damit Sauerstoff. Egal wie gut das Rettungswesen und die Abläufe in der Klinik organisiert sind, es wird immer Situationen geben, in denen die Blutversorgung des Gehirns nicht rechtzeitig wiederhergestellt werden kann. Ist das betroffene Hirnareal groß und betrifft es lebenswichtige Bereiche, kann der Tod die Folge sein.
Ehrliche Kommunikation, aber keine vorschnellen Entscheidungen
Es ist wichtig, die Betroffenen und ihre Angehörigen von Anfang an ehrlich über die Prognose zu informieren, ohne schwarz zu malen, aber auch ohne falsche Sicherheit zu vermitteln. Auch bei einer vermeintlich sehr schlechten Prognose sollte in der Regel für mindestens 48 Stunden eine Maximaltherapie durchgeführt werden, da es sonst zu sogenannten sich selbst erfüllenden Prophezeiungen kommen kann.
Das bedeutet: Die Prognose wird als schlecht eingeschätzt, die Therapie wird reduziert und der Patient verstirbt.4 Neben der tatsächlich schlechten Prognose kann ein negativer Verlauf auch durch den frühzeitigen Abbruch der Therapie verursacht werden.
Es gibt aber Situationen, in denen es legitim ist, von vornherein auf bestimmte invasive Therapiemaßnahmen wie Operationen oder künstliche Beatmung zu verzichten, insbesondere wenn der Patient dies zuvor verfügt hat.
Der Patientenwille zählt, da hilft es, wenn er auch bekannt ist.
Der häufigere Fall dürfte jedoch sein, dass zunächst intensiv behandelt wird. Wenn sich aber in den ersten Tagen der Behandlung herausstellt, dass große Hirnareale irreversibel geschädigt sind, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene wieder selbständig leben kann, sehr gering ist. Spätestens in dieser Situation müssen Behandler und Angehörige gemeinsam darüber sprechen, welcher Zustand für den Betroffenen lebenswert ist und was er sich in einer solchen Situation gewünscht hätte.
Dabei ist es eine große Hilfe, wenn der Betroffene seinen Willen in einer Patientenverfügung schriftlich niedergelegt hat oder wenn er seinen Willen in einer solchen Situation seinen Angehörigen offen mitgeteilt hat. Viele Menschen verdrängen die eigene Sterblichkeit und sprechen wenig über das Sterben, so dass oft nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten entschieden werden muss.
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten
Besonders schwierig in diesen Gesprächen ist der Umgang mit der Unsicherheit prognostischer Aussagen. 100%ige Aussagen kann es in der Medizin wie in den meisten anderen Bereichen nicht geben. Andererseits ist das Bedürfnis nach klaren Aussagen naturgemäß groß, da es sich um eine Entscheidung von großer Tragweite handelt.
In Patientenverfügungen findet sich deshalb häufig die Formulierung “aller Wahrscheinlichkeit nach”, die auch für Aussagen zur Prognose verwendet werden kann. Wenn ein Leben außerhalb einer stationären Pflegeeinrichtung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr möglich sein wird, kann dies für viele Menschen ein Zustand sein, der als nicht lebenswert empfunden wird.
Die Definition eines lebenswerten Lebens ist sehr unterschiedlich und muss immer individuell und mit großer Umsicht betrachtet werden. Es ist wichtig, über alle Möglichkeiten aufzuklären. Also auch über die Möglichkeit, dass eine lebenserhaltende oder -verlängernde Therapie begrenzt oder beendet werden kann und bei entsprechendem Patientenwillen auch soll.
Palliative Therapie nach Schlaganfall
Spätestens in diesem Gespräch fällt oft zum ersten Mal das Wort “Palliativtherapie”. Doch was bedeutet “palliativ” im Zusammenhang mit der Schlaganfallbehandlung?
Bei Schlaganfallpatienten erfolgt die Palliativtherapie meist in dem Krankenhaus, in dem die Behandlung begonnen hat. Die Patienten sind oft so schwer krank und dem Tod so nahe, dass ein Transport in eine Pflegeeinrichtung oder nach Hause nicht in Frage kommt. Die Möglichkeit, während des Transports zu sterben, wird zudem oft als wenig würdevoll empfunden.
Neurologische Abteilungen mit einer Schlaganfallstation, der sogenannten Stroke Unit, verfügen in der Regel über große Erfahrung und Expertise in der palliativen Versorgung von schwer betroffenen Schlaganfallpatienten.
Was genau passiert bei einer palliativen Therapie nach einem schweren Schlaganfall?
Wenn möglich, wird der Patient in ein Einzelzimmer verlegt, Angehörige haben die Möglichkeit, ihn rund um die Uhr zu begleiten. Lebenserhaltende oder lebensverlängernde Medikamente wie Antibiotika, Kreislaufunterstützung oder Blutverdünner werden abgesetzt.
Treten Schmerzen oder Atemnot auf, werden diese Symptome meist mit Morphin behandelt. Die Dosis kann schnell an Veränderungen der Symptome angepasst werden, insbesondere wenn Morphin kontinuierlich über die Vene verabreicht wird. Auch die pflegerischen Maßnahmen werden den neuen Therapiezielen angepasst, es wird alles getan, um Schmerzen und Unwohlsein des Betroffenen zu vermeiden und den Angehörigen eine möglichst ungestörte Begleitung zu ermöglichen.
Flüssigkeitsgabe
Ein Thema, das häufig zur Verunsicherung führt, ist die intravenöse Flüssigkeitsgabe. Häufig wird die Befürchtung geäußert, dass der Patient ohne Flüssigkeitszufuhr verdursten würde. Um das Durstgefühl zu lindern, sollten Lippen und Mund regelmäßig befeuchtet werden. Ist die Schluckfähigkeit noch vorhanden, sollte vorsichtig Flüssigkeit zum Trinken angeboten werden.
Eine intravenöse Flüssigkeitszufuhr wird jedoch nicht generell empfohlen, da es keine Belege dafür gibt, dass sie die Symptome in der Sterbephase lindern kann.6 Die Flüssigkeitszufuhr kann jedoch zu Problemen wie verstärkter Atemnot oder verstärktem sogenannten terminalen Rasseln führen. Das terminale Rasseln ist ein rasselndes oder brodelndes Geräusch bei der Atmung sterbender Menschen, das durch die Ansammlung von Sekret in den oberen Atemwegen verursacht wird.
Hoffnung gibt es immer
Die Ehefrau eines sterbenden Patienten fragte einmal: "Gibt es gar keine Hoffnung mehr?"
Die Antwort darauf ist in jedem Fall ein klares “Nein”. Es gibt immer Hoffnung, solange es Menschen gibt. Auch wenn es in diesem Fall für den Ehemann der Frau nicht möglich war, die Krankheit zu überleben, gibt es weiter Hoffnung, aber sie bezieht sich auf andere Bereiche. Hoffnung, dass ihr Mann nicht leiden muss. Hoffnung, dass er in Würde und im Kreise seiner Lieben sterben kann. Und die Hoffnung, dass er in den Menschen weiterlebt, die er in seinem Leben beeinflusst hat.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Lebenserwartung und Prognose nach einem Schlaganfall
- Was ist ein Schlaganfall?
- Die Behandlung des Schlaganfalls
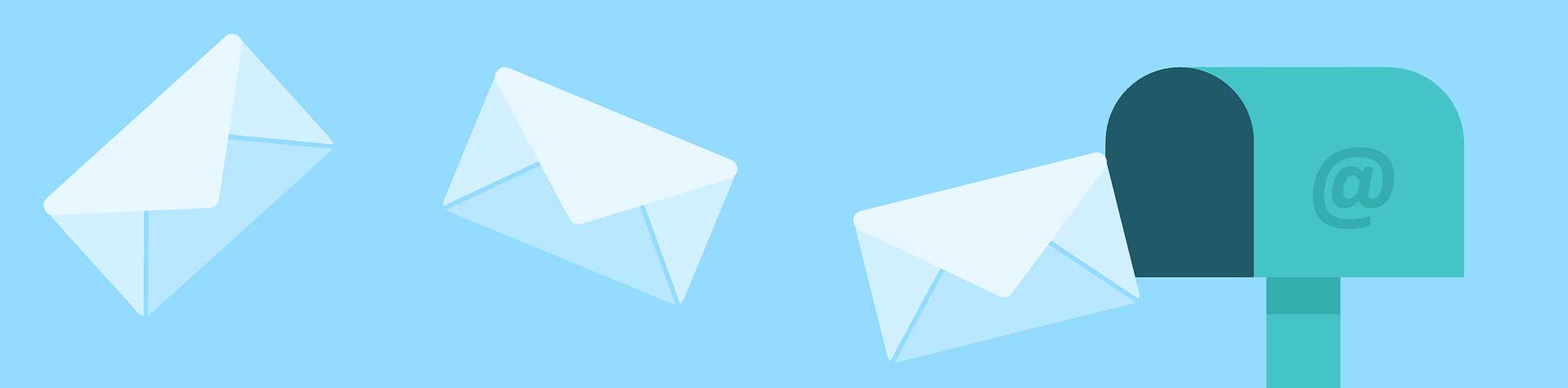
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autor
Dr. med. Johannes Heinemann Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik Freiburg Dr. Johannes Heinemann ist Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik Freiburg. Sein klinischer Schwerpunkt ist die Notfall- und Intensivneurologie. Die Akutbehandlung von Schlaganfallpatienten bereitet ihm große Freude, da hier schnelle Entscheidungen und präzises Handeln gefragt sind. Sein Ziel ist es, Wissen über den Schlaganfall und seine Behandlung verständlich und praxisnah zu vermitteln, um Betroffenen und ihren Angehörigen zu helfen, den Weg der Genesung und Prävention besser zu verstehen und zu meistern. [mehr]
Quellen
- The Frequency and Timing of Recurrent Stroke: An Analysis of Routine Health Insurance Data - Autoren: Stahmeyer JT, Stubenrauch S, Geyer S, Weissenborn K, Eberhard S. - Publikation: Dtsch Arztebl Int. 2019;116(42):711-717 - DOI: 10.3238/arztebl.2019.0711
- Lebenserwartung und Prognose nach einem Schlaganfall - Autor: Büdingen PD med HJ von. - Publikation: Schlaganfallbegleitung. January 28, 2022. Accessed March 21, 2025. URL: https://schlaganfallbegleitung.de/wissen/lebenserwartung-schlaganfall
- Predictors of 30-day mortality in patients with spontaneous primary intracerebral hemorrhage - Autoren: Safatli DA, Günther A, Schlattmann P, Schwarz F, Kalff R, Ewald C. - Publikation: Surg Neurol Int. 2016;7(Suppl 18):S510-517. - DOI: 10.4103/2152-7806.187493
- Withdrawal of support in intracerebral hemorrhage may lead to self-fulfilling prophecies - Autoren: Becker KJ, Baxter AB, Cohen WA, et al. - Publikation: Neurology. 2001;56(6):766-772 - DOI: 10.1212/wnl.56.6.766
- Pschyrembel Online | Palliativmedizin. Accessed March 21, 2025. - URL: https://www.pschyrembel.de/Palliativmedizin/K0G5N
- Medically assisted hydration for adult palliative care patients - Autoren: Good P, Richard R, Syrmis W, Jenkins‐Marsh S, Stephens J. - Publikation: Cochrane Library. Accessed March 22, 2025 - URL: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006273.pub3/full


