Stillen vermindert das Schlaganfall-Risiko ▷ Studie

Stillen vermindert das Schlaganfall-Risiko (Foto: lillolillolillo | Pixabay)
Denn die Vorteile für das Kind sind bekannt: Gestillte Kinder erkranken seltener an Infektionskrankheiten oder Atemwegsinfektionen, um nur einige zu nennen.2,3 Darüber hinaus gibt es einige Hinweise, dass sich das Stillen positiv auf die Gesundheit der Mutter auswirkt.
Die Meta-Analyse
Um den Hinweisen auf die Spur zu kommen, wurde eine Meta-Analyse durchgeführt, die einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Stillen und dem späteren Auftreten einer Herz-Kreislauf-Erkrankung (z. B. Schlaganfall oder Herzinfarkt) bei der Mutter untersuchte.4
Dafür wurden die Daten und Ergebnisse von acht Studien zusammengefasst. Insgesamt wurden damit die Daten von mehr als einer Million Frauen miteinander verglichen.
Die Studien wurden weltweit zwischen 1986 und 2009 durchgeführt. Die Frauen hatten im Durchschnitt 2,3 Kinder. 82 Prozent der Frauen gaben an, ein oder mehrere Kinder gestillt zu haben. Im Durchschnitt haben diese Frauen insgesamt 15,6 Monate ihres Lebens gestillt. Die Frauen wurden im Durchschnitt zehn Jahre lang beobachtet, um ihre langfristige Gesundheit beurteilen zu können.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Ergebnisse der Meta-Analyse
Im Beobachtungszeitraum traten bei den Müttern insgesamt 54.226 Herz-Kreislauf-Ereignisse auf. Davon waren 30.843 Schlaganfälle.
Auf dieser Basis wurde das Auftreten von Herz-Kreislauf-Ereignissen zwischen Müttern, die gestillt hatten, und Müttern, die nicht gestillt hatten, verglichen: Mütter, die ihre Kinder stillten, hatten ein um 11 Prozent geringeres Risiko für ein Herz-Kreislauf-Ereignis und ein um 12 Prozent geringeres Risiko für einen Schlaganfall.
Mögliche Erklärungen
Die Erklärungen für diesen schützenden Effekt bleiben spekulativ. Es wird vermutet, dass Hormone eine wichtige Rolle spielen. Denn während des Stillens werden die Hormone Prolaktin für die Milchproduktion und Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin wird auch als „Bindungs- oder Kuschelhormon“ bezeichnet, da es die Paarbindung bzw. die mütterliche Bindung sowie das Gruppen- und Angstverhalten fördert.
Während Studien zur Wirkung von Prolaktin auf das Herz-Kreislauf-System widersprüchliche Ergebnisse lieferten, konnten für das Bindungshormon Oxytocin günstige Effekte auf das Herz-Kreislauf-Risiko beobachtet werden. So konnte gezeigt werden, dass Oxytocin den Blutdruck senken, die Erweiterung der Blutgefäße fördern und entzündungshemmend wirken kann.5
Eine weitere Hypothese betrifft die Gewichtsabnahme nach der Geburt. Auch wenn dieser Effekt noch umstritten ist, zeigen die Studienergebnisse dieser Meta-Analyse einen Zusammenhang zwischen Stillen und Gewichtsverlust nach der Geburt. Da Übergewicht als Risikofaktor für einen Schlaganfall gilt, ist dieser Zusammenhang wahrscheinlich.
Außerdem könnte das Stillen helfen, den aus dem Gleichgewicht geratenen Zucker- und Fettstoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ein aus dem Gleichgewicht geratener Stoffwechsel kann zu Diabetes und erhöhten Blutfettwerten (bspw. Cholesterin, Triglyceride) führen, was sich ungünstig auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken kann.
Doch damit nicht genug: Neben den positiven Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-Risiko konnte gezeigt werden, dass Stillen auch das Risiko für Diabetes sowie Brust- und Eierstockkrebs senkt.6
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Anti-Baby-Pille kann Schlaganfallrisiko erhöhen
- Geschlechterunterschiede bei Schlaganfällen
- Einem Schlaganfall vorbeugen – wie schütze ich mich?
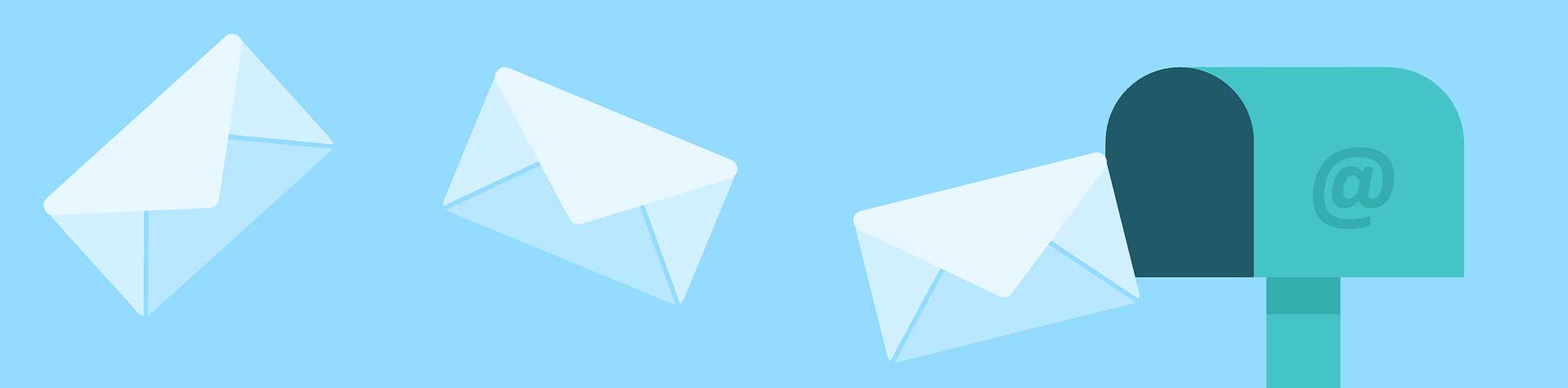
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autorin
Marieke Theil, M.Sc. hält einen Master of Science in Molecular Nutrition und hat sich in Gesundheitspsychologie weitergebildet. Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat sie sich mit dem Einfluss verschiedener Ernährungsformen auf das kardiovaskuläre Risiko befasst. Damit verfügt sie über ein fundiertes Verständnis der Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen. [mehr]
Quellen
- Guideline: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services - World Health Organization - URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/259386
- Optimal Breastfeeding Practices and Infant and Child Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis - Autoren: Sankar, Mari Jeeva, Bireshwar Sinha, Ranadip Chowdhury, Nita Bhandari, Sunita Taneja, Jose Martines et al. - Publikation: Acta Paediatrica, 104.S467 (2015), 3–13 - DOI: 10.1111/apa.13147
- Short-Term Effects of Breastfeeding: A Systematic Review on the Benefits of Breastfeeding on Diarrhoea and Pneumonia Mortality - Autoren: Horta, Bernardo L, Cesar G Victora, World Health Organization - URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/95585
- Breastfeeding Is Associated With a Reduced Maternal Cardiovascular Risk: Systematic Review and Meta‐Analysis Involving Data From 8 Studies and 1 192 700 Parous Women - Autoren: Tschiderer, Lena, Lisa Seekircher, Setor K. Kunutsor, Sanne A. E. Peters, Linda M. O’Keeffe, Peter Willeit - Publikation: Journal of the American Heart Association, 11.2 (2022), e022746 - DOI: 10.1161/JAHA.121.022746
- Oxytocin Revisited: Its Role in Cardiovascular Regulation - Autoren: Gutkowska, J., M. Jankowski - Publikation: Journal of Neuroendocrinology, 24.4 (2012), 599–608 - DOI: 10.1111/j.1365-2826.2011.02235.x
- Breastfeeding in the 21st Century: Epidemiology, Mechanisms, and Lifelong Effect - Autoren: Victora, Cesar G, Rajiv Bahl, Aluísio J D Barros, Giovanny V A França, Susan Horton, Julia Krasevec et al. - Publikation: The Lancet, 387.10017 (2016), 475–90 - DOI: 10.1016/S0140-6736(15)01024-7


