C-reaktives Protein (CRP) ▷ Aussagekraft, Normalwerte und Schlaganfall-Zusammenhang

Das C-reaktive Protein, kurz CRP, ist ein biologischer Marker für Entzündungen (Foto: Jarun Ontakrai | Shutterstock)
In diesem Artikel:
- Was ist das C-reaktive Protein?
- Was sagt das C-reaktive Protein aus?
- Wann sollte das C-reaktive Protein gemessen werden?
- Normalwert des C-reaktiven Proteins
- Wie aussagekräftig sind CRP-Werte?
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem C-reaktiven Protein und einem Schlaganfall?
Das Wichtigste in Kürze:
- Das C-reaktive Protein, kurz CRP, ist ein in der Leber gebildeter biologischer Marker für Entzündungen, der meist im zellfreien Bestandteil des Blutes, dem Blutplasma, bestimmt wird.
- Vor allem bei bakteriellen Infektionen kann das C-reaktive Protein im Blut stark – bis auf das Zehntausendfache des Normalwertes – ansteigen, aber auch nach einem Schlaganfall ist der Blutspiegel meist deutlich erhöht.
- Die CRP-Konzentration wird – in Form des hochsensitiven C-reaktiven Proteins – bei gesunden Menschen auch zur Risikovorhersage für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verwendet.
- Für aussagekräftige medizinische Befunde sollte eine Verlaufskontrolle mit mehreren Messungen in einem bestimmten Zeitraum grundsätzlich einer Einzelbestimmung vorgezogen werden.
Was ist das C-reaktive Protein?
Das in der Leber gebildete C-reaktive Protein gehört zur Klasse der sogenannten Akute-Phase-Proteine und damit zur unspezifischen Immunabwehr. Diese Proteine treten insbesondere bei akuten und chronischen Entzündungsreaktionen des Körpers sowie Gewebeschäden auf. Man nutzt das C-reaktive Protein, kurz CRP, daher auch als Entzündungsmarker. Bei akuten Entzündungen steigt das CRP um das Zehn- bis tausendfache an.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Im Labor wird nach aktuellem Stand üblicherweise das sogenannte hochsensitive CRP, kurz hsCRP, im zellfreien Blutserum bestimmt. Das bedeutet, dass labortechnisch hochempfindliche Messverfahren eingesetzt werden, die bereits geringste Mengen des C-reaktiven Proteins unter 5 mg/L nachweisen können.
Was sagt das C-reaktive Protein aus?
Das CRP ist ein empfindlicher, aber unspezifischer Nachweis für das Vorliegen von Entzündungsprozessen oder dem krankhaften Absterben von Zellen im Körper. Letzteres bezeichnet man in der medizinischen Fachsprache als Nekrose. Beide Prozesse können über spezifische Signalsubstanzen des Immunsystems eine gesteigerte CRP-Bildung auslösen.
Das C-reaktive Protein wird daher vor allem zur frühzeitigen Erkennung entzündlicher Prozesse bei bakteriellen Infektionskrankheiten bestimmt. Bei viralen Infektionen ist der Konzentrationsanstieg üblicherweise sehr gering. Auch der Krankheitsverlauf und der Therapieerfolg bei bakteriellen Infektionen lassen sich durch den CRP-Wert im Blut beurteilen.
Typisch für eine Akute-Phase-Reaktion im Rahmen der unspezifischen Immunabwehr ist ein frühzeitiger starker Anstieg der CRP-Konzentration im zellfreien Bestandteil des Blutes, dem Serum, ab etwa 6 Stunden nach Infektionsbeginn. Innerhalb von 48 Stunden sinkt die Konzentration dann wieder auf normale Werte ab.
Über den diagnostischen Wert bei Infektionen hinaus gilt CRP auch als Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Allgemeinen und Erkrankungen der hirnversorgenden Blutgefäße. Ergänzend wird es als Marker für die Vorhersage der umgangssprachlich als Arterienverkalkung bezeichneten Arteriosklerose eingesetzt. Ein erhöhtes Risiko für diese liegt bei hsCRP-Werten über 3 mg/dL vor.1
Hintergrundwissen: Halbwertszeit des C-reaktiven Proteins
Im zellfreien Bestandteil des Bluts, dem sogenannten Blutserum, hat das C-reaktive Protein eine Halbwertszeit von etwa 19 Stunden.2 Die Halbwertszeit gibt hierbei an, in welchem Zeitraum sich die Konzentration des CRP halbiert. Aus diesem Grund kann das C-reaktive Protein gut als Entzündungsmarker eingesetzt werden. Konzentrationsänderungen, die mit einer Veränderung des Entzündungsprozesses einhergehen, können sehr schnell gemessen und erfasst werden.
Wann sollte das C-reaktive Protein gemessen werden?
Das C-reaktive Protein wird als diagnostischer Laborwert zur Beantwortung einer Vielzahl medizinischer Fragestellungen im Blutserum oder Blutplasma des Patienten bestimmt. Häufig geht der Anstieg dieses Akute-Phase-Proteins ersten sichtbaren Krankheitsanzeichen voraus.
Mögliche Anwendungsgebiete umfassen unter anderem:1
- Vorhersage, Diagnostik und Verlaufskontrolle akuter Entzündungen
- Diagnostik und Verlaufskontrolle von Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel Polymyalgia rheumatica und anderen rheumatischen Erkrankungen
- Kontrolle bei Patienten, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben – unter anderem, wenn eine Immunreaktion beispielsweise im Rahmen von Organverpflanzungen unterdrückt wurde
- Unterscheidungshilfe zur Abgrenzung von bakteriellen von viralen Infektionen, beispielsweise bei einer Hirnhaut- oder Lungenentzündung
- Blutvergiftung durch Erreger bei neugeborenen Kindern, deren Immunität noch nicht ausreichend ausgeprägt ist
- Durch Erreger ausgelöste Komplikationen nach operativen Eingriffen
- Therapiekontrolle unter Verwendung von entzündungshemmenden Medikamenten oder Medikamenten, die das Bakterienwachstum hemmen - sogenannten Antibiotika
- Als Orientierungshilfe bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen von Dickdarm oder Magen-Darm-Trakt, die auch als Colitis ulcerosa beziehungsweise Morbus Crohn bezeichnet werden
- Zur Risikovorhersage für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei gesunden Menschen mittels hochsensitivem CRP
Normalwert des C-reaktiven Proteins
Der Referenzbereich von CRP liegt bei Erwachsenen und Kindern unter 0,5 mg/dL beziehungsweise 5 mg/L. Der optimale Richtwert für das hochsensitive CRP ist unter 0,1 mg/dL (1 mg/L) angesiedelt.3
Wenn keine akuten Entzündungen vorliegen, weist ein hsCRP-Wert zwischen 1,0 und 3,0 mg/L auf ein mäßig erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen durch verengte herzversorgende Blutgefäßen hin. Darüber ist das Risiko deutlich erhöht.
Wie aussagekräftig sind CRP-Werte?
Das C-reaktive Protein ist ein häufig bestimmter Laborwert und gibt schnelle und meist zuverlässige Auskunft über Entzündungsprozesse im Körper. Es gibt jedoch auch einige Einschränkungen.2
Unter anderem bedeuten gemessene CRP-Konzentrationen im Normbereich nicht zwangsläufig, dass keine örtlich begrenzte Entzündung oder eine milde Virusinfektion vorliegen können.
Vor allem kann ein CRP-Wert im Normbereich liegen oder nur leicht erhöht sein, wenn die Entzündung nicht akuter Natur ist, sondern chronisch. In diesem Fall entwickelt sich der entzündliche Prozess entweder nur schleichend oder liegt dauerhaft vor. Üblicherweise spricht ein normaler CRP-Wert jedoch gegen eine gravierende bakterielle Infektion.
Achtung: Veränderungen des CRP-Wertes innerhalb des Referenzbereichs
Nicht nur Erhöhungen des CRP- beziehungsweise hsCRP-Wertes über den Referenzbereich hinaus zeigen krankhafte Prozesse im Körper an. Auch Veränderungen innerhalb des Referenzbereichs sollten beobachtet werden, da der Referenzbereich sehr weit gefasst ist.
Wenn eine akute Entzündung vorliegt, ist die Aussagekraft von hsCRP-Blutwerten in Bezug auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stark eingeschränkt.
Nicht zuletzt kann der Anstieg der CRP-Konzentration im Blut schwächer ausfallen, wenn die Immunantwort unterdrückt ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Immunabwehr künstlich durch Medikamente unterdrückt wurde oder durch Krankheiten beziehungsweise außergewöhnliche Belastungen herabgesetzt wurde.
Hinweis: “Einmal ist keinmal”
Um die Aussagekraft des CRP- beziehungsweise hsCRP-Wertes zu erhöhen, sollten Verlaufskontrollen durchgeführt werden.4 Einzelbestimmungen alleine sagen noch nicht viel aus. Erst die Beobachtung des Verlaufs zeigt, wie schnell und auf welche Konzentration der Wert ansteigt und wann er wieder abfällt. Nur darüber lassen sich - meist im Zusammenhang mit weiteren Untersuchungen - konkrete Diagnosen erheben.
Stellenwert von CRP gegenüber anderen Entzündungswerten
Das C-reaktive Protein eignet sich aus zwei Gründen besonders gut zur Verlaufskontrolle beziehungsweise als Suchtest für Entzündungen:4
- Der Anstieg des CRP verläuft steiler, schneller und somit deutlicher als bei anderen Entzündungsmarkern.
- CRP-Anstiege fallen schneller wieder in den Normbereich ab, wodurch Veränderungen besser sichtbar werden.
Der Höchststand des CRP-Anstiegs wird im Regelfall etwa 48 bis 72 Stunden nach Beginn der Entzündung eintreten.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem C-reaktiven Protein und einem Schlaganfall?
C-reaktives Protein und Schlaganfallrisiko
Eine zusammenfassende statistische Studien-Analyse chinesischer Wissenschaftler im Jahr 2016 deutete darauf hin, dass erhöhte Werte des hochsensitiven C-reaktiven Proteins mit einem gesteigerten Risiko für einen ischämischen Schlaganfall in Verbindung stehen.5 Die Auswirkungen auf das Risiko für eine Hirnblutung waren hingegen nicht eindeutig.
Personen, deren hsCRP-Wert erhöht war, hatten ein um 46 Prozent erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Hirninfarkts. Die Erhöhung des Risikos war bei Männern stärker ausgeprägt.
Bereits Anfang des Jahrtausends konnte in einer Studie nachgewiesen werden, dass die Konzentration an hochsensitivem C-reaktiven Protein im Blut und der Grad der umgangssprachlich als Arterienverkalkung bezeichneten Arteriosklerose in Zusammenhang stehen.6 Die Arteriosklerose ist ein wichtiger Risikofaktor für das Auftreten eines Schlaganfalls.
Für die Studie wurde der hsCRP-Spiegel im Blutserum von insgesamt 302 Männern und Frauen nach ihrem Tod bestimmt. Alle Blutproben stammten von Patienten mit Arterienverkalkung unterschiedlichen Ausmaßes, bei denen keine sonstigen Entzündungen vorlagen.
Die höchsten gemessenen hsCRP-Spiegel traten bei Patienten auf, die an einem akuten Gefäßverschluss verstorben waren. Je geringer der Grad der Arterienverkalkung fortgeschritten war, desto geringer waren auch die gemessenen Konzentrationen des C-reaktiven Proteins.
Schon seit langem gab es Hinweise darauf, dass Entzündungsprozesse eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Blutgerinnseln in Blutgefäßen, die vom Herzen wegführen, spielen. Die dadurch entstehende Minderdurchblutung bis hin zum Gefäßverschluss wird als arterielle Thrombose bezeichnet.
An der sogenannten Physicians Health Study nahmen 543 scheinbar gesunde männliche Ärzte teil, die später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie beispielsweise einem Herzinfarkt oder Schlaganfall erkrankten.7 Weitere 543 Männer, die über die gesamte Nachbeobachtungszeit von acht Jahren keine Gefäßerkrankungen entwickelten, dienten als Kontrolle. Bei den Männern wurde im zellfreien Bestandteil des Blutes die Konzentration des C-reaktiven Proteins bestimmt.
Männer mit den höchsten CRP-Werten hatten ein beinahe dreifach erhöhtes Herzinfarkt-Risiko und ein etwa doppelt so hohes Risiko für einen ischämischen Schlaganfall verglichen mit den Männern, bei denen die niedrigsten CRP-Werte gemessen wurden. Die Konzentration des C-reaktiven Proteins sagte also das Risiko für einen künftigen Schlaganfall oder Herzinfarkt voraus.
Darüber hinaus lieferte diese Arbeit Hinweise darauf, dass entzündungshemmende Medikamente durch Senkung des C-reaktiven Proteins dazu beitragen können, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken und einem Schlaganfall oder Herzinfarkt vorzubeugen.
Ein Arzneimittel zur Senkung von zwei Risikofaktoren für den Schlaganfall
Eine Arbeit aus dem Jahr 2008 beschäftigte sich mit der Fragestellung, ob Patienten mit einem hohen hsCRP-Blutspiegel, aber ohne erhöhte Blutfette dennoch von einer Therapie mit Medikamenten zur Senkung von Blutfetten, den sogenannten Statinen, profitieren könnten.8 In vorangegangenen Arbeiten konnte bereits gezeigt werden, dass die Medikamente neben der Senkung der Blutfette auch erhöhte hsCRP-Spiegel senkten.
Das in der Studie eingesetzte Medikament zur Blutfettsenkung reduzierte die Konzentration des schlechten LDL-Cholesterins um 50 Prozent und die Konzentration des hochsensitiven C-reaktiven Proteins im Blut um 37 Prozent. Darüber hinaus zeigten die Studienergebnisse, dass die Häufigkeit schwerwiegender Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenfalls deutlich gesenkt werden konnte.
Beide Blutwerte - sowohl das schlechte Low Density Lipoprotein Cholesterin, kurz LDL, als auch das C-reaktive Protein - gelten als Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie den Schlaganfall.
Hintergrundwissen: Das Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterin
Beim LDL-Cholesterin handelt es sich um einen Bestandteil des Gesamtcholesterins, der die Entstehung von Arteriosklerose begünstigt und daher ein idealer Marker für das kardiovaskuläre Risiko ist. Das low density lipoprotein, kurz LDL, bezeichnet cholesterinreiche Lipoproteine von geringer Dichte, die Cholesterin aus der Leber in außerhalb der Leber liegende Gewebe transportieren. Der Normwert für das LDL-Cholesterin liegt in einem Referenzbereich von < 4,0 mmol/L beziehungsweise < 155 mg/dL.9
CRP-Spiegel und Schweregrad des Schlaganfalls
Eine im Jahr 2003 publizierte Studie ergab, dass die innerhalb einer Woche nach einem Schlaganfall gemessene Konzentration des C-reaktiven Proteins im Blut im Vergleich zu Kontrollpersonen deutlich erhöht war.10 Des Weiteren blieb der CRP-Spiegel bei Schlaganfall-Patienten auch noch nach 3 bis 6 Monaten nach dem Schlaganfall erhöht - wenn auch niedriger als unmittelbar nach dem Schlaganfall. Betraf der Schlaganfall große Blutgefäße, war der Zusammenhang zwischen gemessenem C-reaktivem Protein und Schlaganfall deutlicher als bei Schlaganfällen, die durch Erkrankung kleinerer Blutgefäße ausgelöst wurden.
Des Weiteren konnte ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Höhe des CRP-Blutspiegels innerhalb einer Woche nach dem Schlaganfall und dem Schweregrad des Schlaganfalls hergestellt werden.
Hinweis: Konzentration des CRP nach einem Schlaganfall
Nach einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt kann die Konzentration des C-reaktiven Proteins Spitzenwerte von bis zu 200 mg/L erreichen. Damit ist der Blutspiegel kurzfristig um das mindestens 40-fache gegenüber dem eines gesunden Erwachsenen erhöht!11
Wie groß das Ausmaß und der Schweregrad eines Schlaganfalls ist, richtet sich hauptsächlich nach der Dauer des Gefäßverschlusses. Es kommt zum Absterben des hierdurch minderversorgten Gewebes. Daran angrenzende Zellen werden zwar auch geschädigt, können jedoch gerettet werden.
Während das Ziel der ersten Therapiemaßnahmen nach einem Schlaganfall die Wiederherstellung des Blutflusses ist, kann ein zweiter Therapieansatz in der Eliminierung von zirkulierendem C-reaktiven Protein bestehen.
Die Wiederherstellung des Blutflusses ist von enormer Bedeutung für die Genesung des Patienten. Durch den Verschluss selbst und die anschließende Wiederherstellung des Blutflusses wird jedoch eine Immunreaktion ausgelöst, die das um den betroffenen Bereich liegende, noch lebensfähige Gewebe schädigen kann.12 Maßgeblich daran beteiligt ist das C-reaktive Protein.
Mit der Methode der sogenannten CRP-Apherese kann zirkulierendes C-reaktives Protein nach einem ischämischen Schlaganfall beseitigt werden, um so die akute Gewebeschädigung zu minimieren. Das CRP wird bei dieser Methode aus dem Blutplasma des Patienten herausgefiltert. Das gereinigte Blutplasma wird dann wieder in den Körper zurückgeführt.
C-reaktives Protein zur Vorhersage der Genesungschancen nach einem Schlaganfall
Chinesische Wissenschaftler untersuchten in einer zusammenfassenden statistischen Analyse von Studien mit gleicher Fragestellung den Zusammenhang zwischen dem hochsensitiven C-reaktiven Protein, kurz hsCRP, als Biomarker für Entzündungsprozesse und den Genesungsaussichten für Schlaganfall-Patientinnen und -patienten.13
Die im Juni 2023 publizierten Ergebnisse der Analyse zeigten, dass hohe hsCRP-Werte mit einer erhöhten Sterblichkeit von Patienten mit einem ischämischen Schlaganfall, dem gesteigerten Risiko für einen erneuten Schlaganfall und schlechten Aussichten für die Genesung der Patienten verbunden waren.
Eine weitere im Jahr 2023 publizierte Studie untersuchte den möglichen Zusammenhang zwischen der Höhe des Blutserumspiegels an C-reaktivem Protein und der funktionellen Einschränkung nach einem Schlaganfall.14 Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass ein hoher CRP-Spiegel 24 Stunden nach dem Schlaganfall mit einem schlechten funktionellen Zustand zusammenhängt.
Diese aktuellen Studienergebnisse stützen die Ergebnisse bereits länger zurückliegender Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen hohen CRP-Spiegeln unmittelbar nach einem Schlaganfall und einer schlechten Genesung beziehungsweise dem Tod hindeuteten.15
C-reaktives Protein und Behandlungserfolg nach Schlaganfall
Entzündungen werden nach aktueller Studienlage mit schlechteren Genesungsvorhersagen nach einem Schlaganfall und anderen Herz-Kreislauferkrankungen in Verbindung gebracht. Deutsche Wissenschaftler untersuchten kürzlich, ob das C-reaktive Protein in der akuten Phase unmittelbar nach einem ischämischen Schlaganfall zur Vorhersage des Behandlungserfolges einer mechanischen Entfernung des Blutgerinnsels mittels Thrombektomie hinzugezogen werden kann.16
In der Studie wurden 676 Patienten untersucht, bei denen das Blutgerinnsel nach Verschluss eines großen hirnversorgenden Blutgefäßes mechanisch entfernt wurde. Bei 313 der Patienten wurden bei der Aufnahme erhöhte Blutspiegel an C-reaktivem Protein nachgewiesen.
Schlechte Behandlungsergebnisse und Tod traten vor allem dann auf, wenn die Schlaganfall-Patienten vor der Thrombektomie erhöhte CRP-Spiegel im Blut hatten. Zudem war auffällig, dass Patienten mit anfänglich erhöhten CRP-Spiegeln auch nach der Thrombektomie einen ausgeprägteren Anstieg des C-reaktiven Proteins im Blut zeigten.
C-reaktives Protein und verminderte Hirnleistung nach dem Schlaganfall
Eine zusammenfassende statistische Analyse von Studien mit gleicher Fragestellung aus dem Jahr 2023 untersuchte, ob erhöhte Blutspiegel des C-reaktiven Proteins mit einer verminderten Hirnleistung nach einem Schlaganfall in Zusammenhang stehen.17 Der Abbau der kognitiven Fähigkeiten ist eine häufige Schlaganfallfolge.
Die Auswertung von insgesamt 9 Studien mit 3893 Teilnehmern legte nahe, dass der Rückgang der Hirnleistung nach einem Schlaganfall mit erhöhten CRP-Spiegeln in Verbindung steht. Ein höherer CRP-Spiegel unmittelbar nach dem Auftreten des Schlaganfalls kann somit auf ein erhöhtes Risiko für den Abbau kognitiver Funktionen hinweisen.
Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die Aussagekraft der Ergebnisse durch die geringe Anzahl an ausgewerteten Daten eingeschränkt ist.
Hintergrundwissen: Was sind kognitive Fähigkeiten?
Unter dem Begriff der kognitiven Fähigkeiten sind alle geistigen Prozesse der Wahrnehmung und des bewussten sowie unbewussten Denkens zusammengefasst.
Diese umfassen beispielsweise:
- Lernen
- Gedächtnisbildung
- Problemlösung
- Orientierung
- Vorstellungskraft
C-reaktives Protein bei transienter ischämischer Attacke (TIA) oder lakunärem Schlaganfall
Ein lakunärer Infarkt ist ein kleinerer Hirninfarkt, der meist durch krankhafte Veränderungen in sehr kleinen Blutgefäßen ausgelöst wird. Meist wird hierbei nur ein kleiner Teil des Gehirns geschädigt, weswegen die Therapiemöglichkeiten sehr gut sind. Bis zu zwei Drittel der Schlaganfälle sind lakunäre Schlaganfälle.18
Eine transiente ischämische Attacke, kurz TIA, bezeichnet hingegen eine kurze, häufig auf wenige Minuten begrenzte Durchblutungsstörung im Gehirn, die Vorbote für einen Schlaganfall sein kann.
Patienten, bei denen bereits ein lakunärer Infarkt oder eine TIA aufgetreten ist, haben ein erhöhtes Risiko für einen (wiederkehrenden) Schlaganfall.19
Britische Wissenschaftler fanden im Jahr 2020 im Rahmen einer Studie heraus, dass geringfügige Entzündungen, die durch Bestimmung des hochsensitiven C-reaktiven Proteins als Entzündungsmarker nachgewiesen wurden, erneute Minderdurchblutungen in hirnversorgenden Blugefäßen vorhersagen können.19
Bereits eine große Studie aus dem Jahr 2001 konnte nachweisen, dass erhöhte Plasmakonzentrationen des C-reaktiven Proteins das Risiko für einen künftigen ischämischen Schlaganfall oder eine TIA bei älteren Menschen unabhängig vom Vorliegen anderer Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen voraussagen können.20
C-reaktives Protein und Hirnvenenthrombose
Die sogenannte Hirn- oder Sinusvenenthrombose verursacht etwa ein Prozent aller Schlaganfälle.21 Diese können in sehr seltenen Fällen mit einer Blutvergiftung einhergehen und werden dann als septische Hirnvenenthrombose bezeichnet. Ohne Blutvergiftung liegt eine aseptische Hirnvenenthrombose vor.
Zur septischen Sinusthrombose kann es kommen, wenn Bakterien oder Pilze von einem Infektionsherd, der meist im Hals-Nasen-Ohren-Bereich liegt, innerhalb des Blutgefäßsystems aufsteigen und die Hirnvene verschließen.22 Nur etwa zehn Prozent der Hirnvenenthrombosen sind septisch, was auf den weltweit starken Einsatz von Medikamenten zur Hemmung des bakteriellen Wachstums - den Antibiotika - zurückzuführen ist.
Zur Unterscheidung zwischen einer Hirnvenenthrombose ohne beziehungsweise mit Blutvergiftung wird eine Laboruntersuchung durchgeführt, bei der unter anderem das C-reaktive Protein als Entzündungsmarker bestimmt wird. Ein erhöhter Wert ist - zusammengenommen mit den anderen Laborwerten - ein erster Hinweis auf das Vorliegen einer Blutvergiftung.
Hintergrundwissen: Biomarker
Ein Biomarker oder biologischer Marker ist ein objektiv messbares biologisches Merkmal. Dieses Merkmal ist charakteristisch für einen Prozess, der im Körper eines gesunden Menschen abläuft. Aus diesem Grund kann der Biomarker als Bezugspunkt beziehungsweise Referenzwert eingesetzt werden, um das Vorliegen einer Erkrankung oder Veränderung eines normalen Prozesses anzuzeigen. Damit ist ein Biomarker ein wichtiges Werkzeug zur Erhebung medizinischer Diagnosen und in einigen Fällen auch zur Vorhersage von Krankheitsverläufen.
Häufig sind Biomarker bestimmte Blutwerte. Auch Gene, Antikörper, Enzyme und andere biologische Moleküle können als biologischer Marker fungieren.
Hintergrundwissen: Woher stammt der Name C-reaktives Protein?
Seinen Namen verdankt das C-reaktive Protein dessen Eigenschaft, am sogenannten C-Polysaccharid, einem Zellwandbestandteil des Bakteriums Streptococcus pneumoniae - dem Krankheitserreger von bakteriellen Lungenentzündungen - zu binden.
Dadurch werden die Bakterien markiert und somit für Komponenten der Immunabwehr sichtbar gemacht. Zudem werden die als Makrophagen bezeichneten Immunzellen und der als Komplementsystem bezeichnete Teil der Immunabwehr (re)aktiviert.1,2 CRP kann aber auch an andere Bakterien, Pilze oder Parasiten binden.
Das Komplementsystem besteht aus einer Enzymkaskade, die der Infektionsabwehr dient. Enzyme sind im Prinzip Proteine, die als biochemische Katalysatoren für bestimmte Reaktionen im Körper fungieren.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Untersuchungen und Diagnose des Schlaganfalls
- Risiko-Vorhersage für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Erhöhtes Schlaganfall-Risiko ab einem Blutdruck von 120/70?
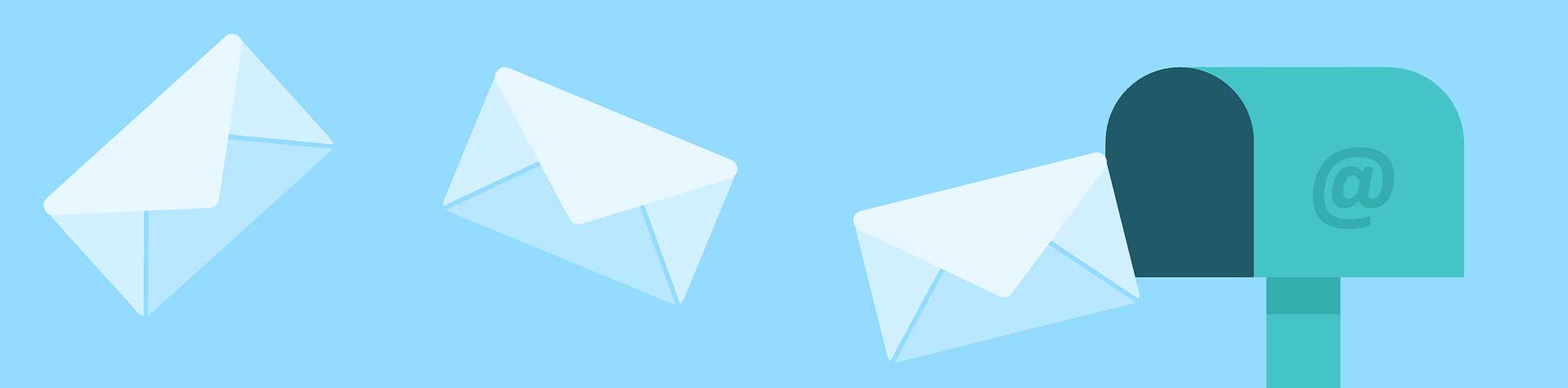
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autoren
Dipl.-Biol. Claudia Helbig unter Mitarbeit von Prof. Dr. med. Hans Joachim von Büdingen
Claudia Helbig ist Diplom-Human- und Molekularbiologin und hat zuvor eine Ausbildung zur Arzthelferin absolviert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Medizinischen Biochemie und Molekularbiologie hat sie Medizinstudenten in Pathobiochemie-Seminaren und Praktika betreut. Nach Ihrer Arbeit in der pharmazeutischen Forschung hat sie in einem Auftragsforschungsinstitut für klinische Studien unter anderem Visiten mit Studienteilnehmern zur Erhebung von Studiendaten durchgeführt und Texte für die Website verfasst. Mit ihrem interdisziplinären Hintergrund und ihrer Leidenschaft zu schreiben möchte sie naturwissenschaftliche Inhalte fachlich fundiert, empathisch und verständlich an Interessierte vermitteln. [mehr]
Quellen
- Pschyrembel Klinisches Wörterbuch; 266. aktualisierte Auflage; 2014 - Autoren: Pschyrembel, Willibald; Arnold, Ulrike - Publikation: Walter de Gruyter & Co. Verlag; Berlin
- Klinikleitfaden Labordiagnostik (2024), 8. Auflage - Autoren: Böhm, Bernhard O.; Niederau, Christoph; Aymanns, Matthias Peter - Publikation: Elsevier Verlag; München - ISBN: 978-3-437-05604-8; 978-3-437-21094-5
- CRP hochsensitiv (hsCRP); (abgerufen am 06.09.2024) - URL: http://leistungsverzeichnis.labor-gaertner.de/entry/282
- Wichtiger Entzündungsmarker: C-reaktives Protein (CRP); LaborInfo; LABOR 28 GmbH Berlin (Stand 04/2019, abgerufen am 13.11.2024) - URL: https://www.labor28.de/media/4535/laborinfo_097_crp_l28.pdf
- Hs-CRP in stroke: A meta-analysis (2016) - Autoren: Zhou, Yongjing; Han, Wei; Gong, Dandan; Man, Changfeng; Fan, Yu - Publikation: Clinica Chimica Acta, Volume 453, 2016, Pages 21-27 - DOI: 10.1016/j.cca.2015.11.027
- Elevated C-Reactive Protein Values and Atherosclerosis in Sudden Coronary Death: Association With Different Pathologies - Autoren: Burke, Allen P.; Tracy, Russell P.; Kolodgie, Frank; Malcom, Gray T.; Zieske, Arthur; Kutys, Robert; Pestaner, Joseph; Smialek, John; Virmani, Renu - Publikation: Circulation. 2002;105(17):2019-2023 - DOI: 10.1161/01.CIR.0000015507.29953.38
- Inflammation, Aspirin, and the Risk of Cardiovascular Disease in Apparently Healthy Men (1997) - Autoren: Ridker, Paul M.; Cushman, Mary; Stampfer, Meir J.; Tracy, Russell P.; Hennekens, Charles H. - Publikation: N Engl J Med. 1997;336(14):973-979 - DOI: 10.1056/NEJM199704033361401
- Rosuvastatin to Prevent Vascular Events in Men and Women with Elevated C-Reactive Protein (2008) - Autoren: Ridker, Paul M.; Danielson, Eleanor; Fonseca, Francisco A. H.; Genest, Jacques; Gotto, Antonio M.; Kastelein, John J. P.; Koenig, Wolfgang; Libby, Peter; Lorenzatti, Alberto J.; MacFadyen, Jean G.; Nordestgaard, Børge G.; Shepherd, James; Willerson, James T.; Glynn, Robert J. - Publikation: N Engl J Med. 2008;359(21):2195-2207 - DOI: 10.1056/NEJMoa0807646
- Laborwerte: Referenzbereiche; Thieme via medici; (abgerufen am 06.09.2024) - URL: https://viamedici.thieme.de/lernmodul/15855707/15855706/laborwerte+referenzbereiche
- C-reactive protein in ischemic stroke and its etiologic subtypes (2003) - Autoren: Eikelboom, John W., Hankey, Graeme J.; Baker, Ross I.; McQuillan, Andrew; Thom, Jim; Staton, Janelle; Cole, Vanessa; Yi, Qilong - Publikation: Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Volume 12, Issue 2, 74 - 81 - DOI: 10.1053/jscd.2003.16
- C-reaktives Protein (CRP): ein diagnostischer Entzündungsmarker am Beispiel ausgewählter Indikationen (2024) - Autoren: Oremek, G. M.; Holzgreve, F.; Wanke, E. M.; Germann, U; Ohlendorf, Daniela - Publikation: Zbl Arbeitsmed 2024 · 74:140–144 - DOI: 10.1007/s40664-023-00523-y
- Selective Apheresis of C-Reactive Protein for Treatment of Indications with Elevated CRP Concentrations - Autoren: Kayser, Stefan; Brunner, Patrizia; Althaus, Katharina; Dorst, Johannes; Sheriff, Ahmed (2020) - Publikation: J Clin Med. 2020;9(9):2947 - DOI: 10.3390/jcm9092947
- The role of high-sensitivity C-reactive protein serum levels in the prognosis for patients with stroke: a meta-analysis (2023) - Autoren: Chen, Liuting; Wang, Min; Yang, Chanrui; Wang, Yefei; Hou, Bonan - Publikation: Front. Neurol. 14:1199814 - DOI: 10.3389/fneur.2023.1199814
- CRP as a potential predictor of outcome in acute ischemic stroke (2023) - Autoren: Bian, Jing; Guo, Siping; Huang, Tingting; Li, Xiuyun; Zhao, Shoucai; Chu, Zhaohu; Li, Zibao - Publikation: Biomed Rep. 2023;18(2):17 - DOI: 10.3892/br.2023.1599
- C-reactive protein in the very early phase of acute ischemic stroke: association with poor outcome and death (2009) - Autoren: The PAIS Investigators; Hertog, H. M.; Rossum, J. A.; Worp, H. B.; Gemert, H. M. A.; Jonge, R.; Koudstaal, P. J.; Dippel, D. W. J. - Publikation: J Neurol. 2009;256(12):2003-2008 - DOI: 10.1007/s00415-009-5228-x
- Inflammation in stroke: initial CRP levels can predict poor outcomes in endovascularly treated stroke patients (2023) - Autoren: Finck, Tom; Sperl, Philipp; Hernandez-Petzsche, Moritz; Boeckh-Behrens, Tobias; Maegerlein, Christian; Wunderlich, Silke; Zimmer, Claus; Kirschke, Jan; Berndt, Maria - Publikation: Front Neurol. 2023;14:1167549 - DOI: 10.3389/fneur.2023.1167549
- C-Reactive Protein Levels and Cognitive Decline following Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis (2023) - Autoren: Wang, Likun; Yang, Lining; Liu, Haiyan; Pu, Juncai; Li, Yi; Tang, Lu; Chen, Qing; Pu, Fang; Bai, Dingqun - Publikation: Brain Sci. 2023 Jul 17;13(7):1082 - DOI: 10.3390/brainsci13071082
- Lakunäre Schlaganfälle - Autoren: Dr. med. Barow, Ewgenia; Prof. Dr. med. Thomalla, Götz (24.06.2020) - Publikation: InFo Neurologie + Psychiatrie, Ausgabe 6/2020; Springer Medizin Verlag GmbH - URL: https://www.springermedizin.de/magnetresonanztomografie/zerebrale-ischaemie/lakunaere-schlaganfaelle/18078072
- C-Reactive Protein Predicts Further Ischemic Events in Patients With Transient Ischemic Attack or Lacunar Stroke (2020) - Autoren: Mengozzi, Manuela; Kirkham, Frances A.; Girdwood, Esme E. R.; Bunting, Eva; Drazich, Erin; Timeyin, Jean; Ghezzi, Pietro; Rajkumar, Chakravarthi - Publikation: Front Immunol. 2020;11:1403 - DOI: 10.3389/fimmu.2020.01403
- Plasma Concentration of C-Reactive Protein and Risk of Ischemic Stroke and Transient Ischemic Attack: The Framingham Study (2001) - Autoren: Rost, N. S.; Wolf, P. A.; Kase, C. S.; Kelly-Hayes, M.; Silberschatz, H.; Massaro, J. M.; D’Agostino, R. B.; Franzblau, C.; Wilson, P. W. F. - Publikation: Stroke; Volume 32, Issue 11, 1 November 2001; Pages 2575-2579 - DOI: 10.1161/hs1101.098151
- Hirn- und Sinusvenenthrombose (SVT): Symptome, Ursachen, Behandlung; Deutsche Hirnstiftung e. V. (abgerufen am 14.11.2024) - URL: https://hirnstiftung.org/alle-erkrankungen/hirn-und-sinusvenenthrombose-svt/
- Praxishandbuch Schlaganfall, 1. Auflage - Autoren: Kraft, Peter; Köhrmann, Martin - Publikation: Urban & Fischer Verlag/ Elsevier GmbH 2020 - ISBN/eISBN: 978-3-437-23431-6; 978-3-437-09754-6


