Empfindungsstörungen nach Thalamusinfarkt ▷ Schlaganfall-Folgen

Empfindungsstörungen oder Missempfindungen nach einem Thalamusinfarkt sind vielfältig und können sich im Alltag sehr belastend auswirken. (Foto: Roman Bodnarchuk | Shutterstock)
In diesem Artikel:
- Das Wichtigste in Kürze
- Was ist ein Thalamusinfarkt?
- Mögliche Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt
- Das Thalamus-Schmerz-Syndrom
- Fragen und Antworten zu Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt
- Den Heilungsprozess fördern und Empfindungsstörungen lindern
Das Wichtigste in Kürze:
Für alle, die gleich in die Tiefe gehen und mehr wissen möchten: Hier geht es zur ausführlichen Version des Artikels.Der Thalamusinfarkt ist ein Schlaganfall infolge einer Durchblutungsstörung im Thalamus.
Empfindungsstörungen oder Missempfindungen nach einem Thalamusinfarkt sind vielfältig und können sich im Alltag sehr belastend auswirken. Häufige Empfindungsstörungen sind Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder stechende Schmerzen.
Beschwerden wie Missempfindungen oder Schmerzen entstehen dabei nicht nur durch eine veränderte Empfindung, sondern auch durch Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung.
Der Thalamus spielt dabei eine entscheidende Rolle: Er filtert, gewichtet und integriert Sinneseindrücke. Wird dieser Filtermechanismus gestört, werden Reize unscharf, falsch priorisiert oder überlagern sich.
Die Folgen eines Thalamusinfarktes sind komplex, und das erklärt auch, warum ein Behandlungsansatz erforderlich ist, der verschiedene Methoden einschließt.
Empfindungsstörungen sind nicht ungewöhnlich. Sie treten oft in der Phase der neurologischen Erholung auf und können mit Reparatur- und Anpassungsprozessen des Gehirns zusammenhängen. Das Gehirn nutzt seine Neuroplastizität, um neue Nervenverbindungen auszubilden und die Funktion der Nervenzellen zu ersetzen, die durch den Schlaganfall geschädigt wurden.
Dieser Prozess wird oft in unangenehmen Missempfindungen spürbar, die erst einige Monate nach dem Schlaganfall im Alltag auftreten. Nicht immer nehmen Betroffene die Beschwerden bewusst wahr. Dadurch lassen sich Empfindungsstörungen oft nicht klar einordnen oder beschreiben.
Wenn sich ihre Art, Häufigkeit, Ausprägung oder Intensität deutlich verändert, sollten Empfindungsstörungen ärztlich untersucht werden. Neu auftretende Missempfindungen sind keine unmittelbare Alarmmeldung. Sie sollten jedoch immer ernst genommen und neurologisch abgeklärt werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Heilungsprozess zu unterstützen und Beschwerden zu lindern, etwa Physio- und Ergotherapie oder Entspannungstechniken. Ein Selbsthilfe-Forum, Gesundheits-Apps oder Tagebücher können helfen, die eigenen Empfindungsstörungen besser zu verstehen und anzunehmen.
Bei starken Missempfindungen und zentralen Schmerzen ist eine individuell abgestimmte medikamentöse Behandlung oft unverzichtbar.
Viele Betroffene profitieren davon, wenn sie verschiedene Methoden schrittweise ausprobieren und sich dabei therapeutisch begleiten lassen, um herauszufinden, was individuell am besten hilft.
Ein strukturierter Alltag, professionelle Begleitung und der Austausch mit anderen Betroffenen können dabei helfen, den Heilungsweg zu erleichtern.
Das Thalamus-Schmerz-Syndrom
Jede zehnte bis vierte betroffene Person entwickelt nach dem Thalamusinfarkt ein sogenanntes Thalamus-Schmerz-Syndrom5, eine Störung der zentralen Reizverarbeitung.
Zwei Ebenen wirken zusammen, wenn das Gehirn Reize nicht mehr korrekt lokalisieren, unterscheiden oder integrieren kann:
- Empfindungsstörungen („Was spüre ich?“): entstehen durch eine veränderte oder schmerzhafte Wahrnehmung von Reizen.
- Verarbeitungsstörungen („Wie ordne ich es ein?“): beziehen sich auf Schwierigkeiten auf höherer Ebene, Reize zu verarbeiten und zu interpretieren.
Die Beschwerden entstehen also nicht nur durch eine gestörte Empfindung, sondern vor allem durch eine veränderte Verarbeitung von Reizen im Thalamus.
Der Thalamus ist bei dem Schmerzsyndrom mit einem überlasteten Torwächter vergleichbar: Normalerweise lässt er nur relevante Signale durch (beispielsweise „Hand berührt heiße Herdplatte → Schmerz → Rückzug“). Nach einem Infarkt drängen alle Signale ungefiltert ins Bewusstsein. Harmlose Reize (Bettdecke, Luftzug) werden als Bedrohung fehlinterpretiert.
Das Thalamus-Schmerz-Syndrom19,20,21 ist ein eigenes Erkrankungsbild mit weiteren Folgen wie motorischen oder vegetativen Begleiterscheinungen. Oft verstärken Unsicherheit und Erwartungsangst die Schmerzen.
Es gibt Therapiebeispiele, in denen sich die komplexen und quälenden Symptome lindern lassen. Was hilft, sind Orientierung statt Überforderung, Geduld und ein stabiles „Trotzdem”. Die Behandlung bleibt jedoch eine Herausforderung und bedarf weiterer Forschung.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Was ist ein Thalamusinfarkt?
Der Thalamusinfarkt ist ein Schlaganfall infolge einer Durchblutungsstörung im Thalamus.
Kommt es zu einem Verschluss eines Blutgefäßes, werden die umliegenden Zellen nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Nervenzellen verlieren ihre Funktion und es treten neurologische Störungen auf.
Etwa 3 bis 4 Prozent aller ischämischen Hirninfarkte betreffen den Thalamus.16 Da der Thalamus eine hochspezialisierte Hirnregion ist, führen Infarkte hier - je nach betroffenem Areal - zu unterschiedlichen klinischen Syndromen, wie Empfindungsstörungen, Bewegungsstörungen oder kognitiven Defiziten.13,14,15
Isolierte Thalamusinfarkte (ohne Beteiligung benachbarter Strukturen wie des Mittelhirns) sind seltener. Unter den lakunären Infarkten, die durch die Verstopfung kleinster Hirngefäße verursacht werden, liegt der thalamische Anteil bei 9 bis 15 Prozent.17
Der Thalamus
Der Thalamus1 ist die größte Ansammlung grauer Substanz im Zwischenhirn. Diese besteht aus Milliarden von Nervenzellen. Der Thalamus ist unter der Großhirnrinde gelegen und über Fasersysteme mit ihr und anderen Teilen des zentralen Nervensystems (ZNS) verbunden.
Als zentrale Sammel- und Umschaltstelle verarbeitet der Thalamus fast alle Reize aus Umwelt und Innenwelt, die von den Sinnesorganen aufgenommen und zur Großhirnrinde weitergeleitet werden sollen.
Zu den aufgenommenen Informationen zählen beispielsweise Berührungs-, Schmerz- und Temperaturempfindungen. Der Thalamus filtert und sortiert diese Eindrücke, bevor sie ins Bewusstsein gelangen. Durch seine Funktion trägt er wesentlich dazu bei, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren.
Welche Empfindungsstörungen können nach einem Thalamusinfarkt auftreten?
Empfindungsstörungen (somatosensorische Störungen)
Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt äußern sich vielfältig - von unangenehmen Missempfindungen bis hin zu Störungen der Körperwahrnehmung. Betroffene beschreiben häufig:
- Kribbeln, oft beschrieben als „Ameisen, die unter der Haut laufen“ oder „elektrische Impulse“, ohne äußeren Reiz
- Brennen, ein intensives Wärmegefühl, das auch mit „Feuer unter der Haut“ oder „wie heißes Öl über die Haut gegossen“ verglichen wird, aber ohne sichtbare Rötung
- stechende Schmerzen, die plötzlich wie ein Messerstich oder Stromschlag auftreten und Sekunden anhalten können, oft ohne Warnung
- Taubheitsgefühl, ähnlich wie nach einer Spritze beim Zahnarzt oder als ob die Haut abgestorben wäre, oft begrenzt auf bestimmte Körperregionen
Diese Phänomene weisen vor allem auf eine Störung der Oberflächensensibilität hin. Hinzu kommen Störungen der Tiefensensibilität, damit ist das unbewusste Gefühl für Körperhaltung, Bewegung und Krafteinschätzung gemeint. Diese äußern Betroffene zum Beispiel als:
- „unsicheres Gefühl im Körper"mit Gleichgewichtsstörung, etwa beim Treppensteigen
- häufiges Stolpern mit Gangunsicherheit: „als würde der Boden unter mir weggegeben”
- Schwierigkeiten beim Greifen, wie: „Ich lasse Dinge einfach fallen, ohne es zu merken”
Wichtig: Gerade dann, wenn der Schlaganfall nicht zu einer Lähmung geführt hat und die Betroffenen die Beschwerden nicht einordnen können, nehmen sie diese Störungen oft nicht bewusst wahr. Dadurch sind sie auch nur schwer zu erklären.
Oft fallen sie erst einige Monate nach dem Schlaganfall im Alltag auf. Beispielsweise beim Anziehen oder in neurologischen Tests, wie dem Romberg-Stehtest, jedoch nicht in der Akutbehandlung oder während der Reha.
Wie unterscheiden sich Empfindungsstörungen, Missempfindungen und Sensibilitätsstörungen?
Empfindungsstörungen sind eine allgemeine Bezeichnung für wahrgenommene Abweichungen im Fühlen (beispielsweise Taubheit oder Überempfindlichkeit).
Missempfindungen unterscheiden sich davon durch unangenehme oder verfälschte Empfindungen ohne klaren äußeren Reiz wie Kribbeln oder Brennen.
Sensibilitätsstörungen sind der medizinische Begriff für durch Tests objektivierbare Befunde.
Beispiel:
„Meine Hand fühlt sich an, als würde sie brennen“ (Missempfindung) und
„Ich spüre die Berührung nicht“ (Sensibilitätsstörung, aufgehobene Berührungsempfindung)
In der neurologischen Untersuchung zeigen sich oft kombiniert oder einzeln folgende typische Befunde nach einem Thalamusinfarkt:
- Hypästhesie: herabgesetzte Berührungsempfindung (beispielsweise „Ich spüre leichte Berührungen nicht“)
- Anästhesie: vollständige Empfindungslosigkeit (zum Beispiel „Als wäre die Haut betäubt“)
- Parästhesien: nicht-schmerzhafte Missempfindungen (unter anderem „Ameisenlaufen“)
- Dysästhesien: schmerzhafte Verfälschungen (zum Beispiel „Streicheln fühlt sich an wie Kratzen“).
- Störungen der Tiefensensibilität, wie Pallhypästhesie: herabgesetzter Vibrationssinn (beispielsweise „Ich spüre das Vibrieren meines Handys nicht“) oder gestörter Lage- und Bewegungssinn (zum Beispiel „Ich weiß nicht, wo mein Arm ist, ohne hinzuschauen“)
Meist treten diese Symptome kontralateral auf, also auf der gegenüberliegenden Seite des Thalamusinfarkts. Aber sie kommen seltener auch ipsilateral vor, auf derselben Seite.

Drei häufige Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt. So beschreiben es Betroffene: „Meine Hand ist wie eingeschlafen, aber sie wacht nicht auf, es kribbelt wie Ameisen.“ (Kribbeln/Taubheit) „Plötzlich sticht es wie ein Messer - nur für Sekunden, aber so heftig, dass ich die Luft anhalte.“ (Stechen) “Mein Arm brennt wie Feuer oder wie heißes Öl, das mir jemand über die Haut gegossen hat.” (Brennen)
Diese spontanen Symptome treten ohne äußeren Reiz auf und sind typisch für zentrale Schädigungen, im Gegensatz zu peripheren Nervenschäden wie zum Beispiel bei Diabetes mellitus.
Seltene und atypische Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt
Begrenzte Gesichtsregion-Empfindungsstörung
Nach einem Thalamusinfarkt können auch plötzliche Empfindungsstörungen auf eine Gesichtsregion begrenzt bleiben, ohne dass andere Körperbereiche betroffen sind.2
Betroffene berichten dann beispielsweise über einseitige Taubheitsgefühle oder eine abgeschwächte Wahrnehmung in einem kleinen Areal, etwa an der Wange oder den Lippen. In schweren Fällen – etwa nach zwei aufeinanderfolgenden Thalamusinfarkten in unterschiedlichen Regionen – können sich daraus starke, anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen entwickeln.3
Numb Chin Syndrome (Taubes-Kinn-Syndrom)
Sehr selten kann ein Thalamusinfarkt zu einseitiger Taubheit am Kinn und an der Unterlippe führen: das Numb Chin Syndrome (wörtlich übersetzt: Taubes-Kinn-Syndrom).2 Es ist auch bekannt als Vincent-Syndrom oder sensorische Neuropathie des Nervus mentalis.
Häufiger verursacht wird es jedoch durch periphere Schädigungen (unter anderem durch zahnärztliche Eingriffe, Verletzungen oder Tumorerkrankungen). Falls es nach einem Schlaganfall auftritt, liegt meist eine Schädigung der zentralen Bahnen vor, etwa im Hirnstamm oder Thalamus. Hierzu sind, ebenso wie im Rahmen von Multipler Sklerose, bislang nur Einzelfälle dokumentiert.
Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung (höhere integrative Störungen)
Neben Empfindungsstörungen treten nach einem Thalamusinfarkt sehr häufig Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung auf.
Diese gehen über eine reine Sensibilitätsstörung hinaus, denn die Wahrnehmungsstörung betrifft höhere integrative Funktionen der zentralen Organisation: Hier geht es um somatosensorische Verarbeitung im Thalamus und seinen Netzwerken.
Diese zentralen Verarbeitungsstörungen sind auch beim Thalamus-Schmerzsyndrom typisch und tragen zur Komplexität der Beschwerden bei.
Störung der Reizdiskrimination (betrifft Unterscheidungsfähigkeit)
Ein häufiges Phänomen ist die gestörte Reizdiskrimination, die Unfähigkeit, wahrgenommene Reize eindeutig räumlich oder qualitativ zuzuordnen. Betroffene schildern zum Beispiel:
- „Ich spüre, dass jemand meine Hand berührt, aber ich weiß nicht, ob es die linke oder die rechte Hand ist.“
- „Ich merke Druck, aber nicht, ob es stark oder schwach ist. Es ist, als wäre meine Haut wie Gummi.“
Diese Einschränkungen beruhen auf Schädigungen der thalamischen Relaiskerne, die für die präzise Lokalisation und Differenzierung somatosensorischer Informationen zuständig sind.
Somatosensorische Gating-Störung (betrifft Reizfilterung)
Besonders beeinträchtigend ist die Störung des somatosensorischen Gatings, also die Schwierigkeit, mehrere Reize gleichzeitig sinnvoll zu verarbeiten.
Betroffene nehmen Reize nicht nur schwächer wahr, sondern erleben sie als überlagernd oder unspezifisch. Sie können einzelne Reize zwar spüren, aber sobald mehrere gleichzeitig auftreten, fällt es ihnen schwer, diese klar zu unterscheiden.
Diese Form der Wahrnehmungsverarbeitungsstörung betrifft die Art und Weise, wie das Gehirn gleichzeitig eintreffende Reize verarbeitet, filtert und organisiert. So schildern Betroffene etwa:
- „Wenn nur meine rechte Hand berührt wird, merke ich das deutlich. Werden beide Hände gleichzeitig berührt, nehme ich die rechte Seite viel schwächer wahr.“
- „Wenn ich in einem vollen Raum stehe und jemand mich an der Schulter antippt, spüre ich es. Aber sobald zwei Leute mich gleichzeitig berühren, ist alles nur noch ein verwirrendes Durcheinander.“
Astereognosie (betrifft Tasterkennung)
Die sogenannte Astereognosie beschreibt eine Schwierigkeit des Tasterkennens von Objekten, obwohl das Berührungsempfinden intakt sein kann. Ein Betroffener beschreibt es so:
„Sie können sich das so vorstellen, als ob sie mit geschlossenen Augen einen Schlüsselbund in der Hand haben. Sie spüren genau, dass da etwas ist. Aber ob es ein Schlüssel, eine Münze oder ein Stein ist, bleibt ein Rätsel. Selbst wenn Sie es zwischen den Fingern drehen, fühlt es sich einfach an wie ein ‚Ding ohne Form‘.“
Astereognosie weist auf eine Beeinträchtigung der sensorischen Integration im Thalamus und den assoziierten kortikalen Arealen hin. Sie ist beim Thalamusinfarkt häufig kombiniert mit gestörter Tiefensensibilität.
Die Störung kann zudem indirekt zur Schmerzverstärkung beitragen (siehe Erklärung beim Thalamus-Schmerzsyndrom).
Das bedeutet: Es handelt sich um eine qualitative Veränderung der Reizverarbeitung. Solche zentral bedingten Wahrnehmungsstörungen können sehr irritierend sein. Oftmals bessern sie sich jedoch im Verlauf, wenn das Gehirn seine Filtermechanismen neu organisiert.
Das Filter-System erklärt: Was bedeutet „Gating“?
„Gating“ (engl. gate = Tor) beschreibt den Filtermechanismus des Gehirns.
Vereinfacht gesagt, wirkt der Thalamus als „Torwächter zum Bewusstsein“, weil er filtert: Nicht jedes Signal aus der Peripherie wird zur Information, nur was er „durchlässt“, gelangt in die Großhirnrinde (Kortex) und kann Bedeutung erlangen.
Das ist wichtig, weil ständig Reize aus den Sinnesorganen eintreffen (Reiz = physikalischer oder chemischer Stimulus aus der Umwelt oder dem Körperinneren), zum Beispiel Druck, Temperatur, Schmerzreiz.
Jeder Reiz muss ein Nervensignal auslösen (= elektrische oder chemische Aktivität), um in biologisch anschlussfähiger Form im Nervensystem weitergeleitet zu werden (als Aktionspotenziale oder synaptische Übertragung). Aber erst, wenn Signale zentral verarbeitet und bewertet werden, vor allem im Thalamus und im Kortex, entsteht „Information“. Diese kann bewusst wahrgenommen oder unbewusst weiterverarbeitet werden.
Der Thalamus sortiert also diese Signale und entscheidet, welche davon als Information zur Großhirnrinde weitergeleitet werden. Relevantes wird bevorzugt, Unwichtiges abgeschwächt, Störsignale werden gedämpft. So können wir trotz Nebengeräuschen ein Gespräch verstehen, weil die Stimme unseres Gegenübers durchgelassen wird, während Hintergrundsignale unterdrückt werden.
Bei einer Gating-Störung bricht diese Auswahl zusammen:
Reize überlagern sich, lassen sich schwerer unterscheiden oder sie werden falsch gewichtet. Dies erklärt zum Teil, warum Empfindungen und Beschwerden nach einem Thalamusinfarkt so stark sein können, intensiver wahrgenommen werden und warum der Alltag anstrengender erscheint. Selbst wenn nicht mehr Reize auf den Körper einwirken. Es kostet mehr Energie.
Wenn Schmerz zur Qual wird: Das Thalamus-Schmerz-Syndrom
Nach einem Thalamusinfarkt entwickelt etwa jede zehnte bis vierte betroffene Person ein sogenanntes Thalamus-Schmerzsyndrom5.
Es wird auch als zentrales Schmerzsyndrom nach Schlaganfall (CPSP, Central Post-Stroke Pain) bezeichnet. In älteren Publikationen findet sich noch die historische Bezeichnung Déjerine-Roussy-Syndrom.
Die Häufigkeit variiert je nach betroffener Hirnregion und je nach Studie: Während es nach isolierten Thalamusinfarkten in diesem Bereich von 8 bis 25 Prozent liegt, ist es nach Schlaganfällen im Hirnstamm oder im Kortex seltener.
Viele Fälle bleiben jedoch unerkannt oder werden nicht korrekt klassifiziert, weil die Symptome oft diffus und schwer einzuordnen sind.
Ein Schmerzbild mit eigenem Charakter – oft verkannt
Das Thalamus-Schmerzsyndrom gehört zu den komplexesten und quälendsten Folgen eines Thalamusinfarkts. Es kann sofort, nach Monaten oder sogar Jahren auftreten. Die Symptome sind meist chronisch und schwer behandelbar.
Im Unterschied zu peripheren Nervenschädigungen - etwa bei einer diabetischen Neuropathie - liegt hier eine Störung der zentralen Reizverarbeitung im Gehirn vor. Der Thalamus, als tief im Gehirn gelegene Umschalt- und Integrationsstation, verarbeitet normalerweise Sinnesreize und leitet sie an die Großhirnrinde weiter. Wird dieser Bereich geschädigt, gelangen Reize ungefiltert, übersteigert oder fehlinterpretiert ins Bewusstsein.
Symptome verstehen: Was wird gespürt und wie wird es verarbeitet?
Zur besseren Einordnung hilft wieder die Unterscheidung zwischen zwei Ebenen:
- Empfindungsstörungen („Was spüre ich?“): entstehen durch eine veränderte oder schmerzhafte Wahrnehmung von Reizen.
- Verarbeitungsstörungen („Wie ordne ich es ein?“): beziehen sich auf Schwierigkeiten auf höherer Ebene, Reize zu verarbeiten und zu interpretieren.
Diese beiden Ebenen wirken auch zusammen, wenn das Gehirn Reize nicht mehr korrekt lokalisieren, unterscheiden oder integrieren kann.
Viele Betroffene schildern dadurch, dass sie ihrer Körperwahrnehmung nicht mehr vertrauen können. Berührungen fühlen sich fremd oder irritierend an, selbst wenn sie früher als angenehm empfunden wurden. Und diese Unsicherheit kann den Schmerz sogar verstärken.
Neurophysiologische Mechanismen: Was passiert im Gehirn?
Die Beschwerden entstehen also nicht nur durch eine gestörte Empfindung, sondern vor allem durch eine veränderte Verarbeitung von Reizen im Thalamus. Nach derzeitigem Forschungsstand können mehrere neurophysiologische Mechanismen dabei eine Rolle spielen:
- Verlust der hemmenden Kontrolle: Normalerweise bremsen Nervenzellen selbst überaktive Reize im Thalamus. Bei einer Schädigung reduziert sich diese Schutzfunktion. Es kommt vermehrt zu Schmerzsignalen, auch ohne Reiz.
- Überaktivität der Nervenzellen: Geschädigte Zellen feuern spontan und unkontrolliert. Dies trägt zu brennenden oder stechenden Schmerzen ohne Auslöser bei.
- Ungleichgewicht der Botenstoffe: Erregende Neurotransmitter (Glutamat) überwiegen, während hemmende (GABA) vermindert sind. Das verschiebt das Reizniveau nach oben und das Gehirn steht im Dauerstress.
- Fehlverarbeitung von Sinnesreizen: Ist der Filtermechanismus gestört, können selbst normale Reize wie Berührung oder Temperatur nicht mehr richtig gefiltert, gewichtet oder interpretiert werden. Der Körper meldet Alarm, obwohl keine Gefahr besteht.
Klinische Symptomatik im Rahmen eines Thalamus-Schmerz-Syndroms
Weit über wahrnehmungsbezogene Störungen hinaus
Das Thalamus-Schmerz-Syndrom19,20,21 ist ein eigenes Erkrankungsbild mit weiteren Symptomen wie motorischen oder vegetativen Begleiterscheinungen. Dieser Artikel beschränkt sich auf sensorische und wahrnehmungsbezogene Störungen nach einem Thalamusinfarkt.
Die Symptome sind meist auf der dem Infarkt gegenüberliegenden Körperseite zu spüren. Seltener können sie auch auf derselben Seite auftreten, vor allem bei einer ausgedehnten Schädigung oder im Verlauf, wenn das Gehirn nach dem Schlaganfall neue Umleitungen bildet. Solche Ersatznetzwerke sind oft hilfreich zum Ersatz von Funktionen. Sie können aber auch dazu führen, dass Empfindungen an ungewohnter Stelle oder diffus wahrgenommen werden.
Typische Beschwerden aus Sicht Betroffener – Empfindungsstörungen
- Spontaner Schmerz ohne äußeren Reiz: Starke, brennende, einschießende oder pochende Schmerzen, oft begleitet von Parästhesien (wie unangenehmes Kribbeln) oder Dysästhesien (schmerzhafte Reize, die sich verändert oder falsch anfühlen)„Es fühlt sich an wie ein Stromschlag: Der Schmerz schießt blitzartig und stechend ein.“
„Plötzlich brennt mein Arm, als hätte mir jemand heißes Öl über die Haut gegossen.“ - Überempfindlichkeit (Allodynie, Hyperästhesie): Selbst leichte Reize wie Berührung, Temperatur oder Kleidung werden als unangenehm oder schmerzhaft empfunden.„Wenn nur die Bettdecke meine Haut berührt, fühlt es sich an wie glühender Draht.“
- Gestörte Temperaturwahrnehmung: Verminderte Empfindung für Wärme und Kälte oder Unfähigkeit, Unterschiede korrekt wahrzunehmen“Wenn ich meine Hand ins heiße Wasser halte, spüre ich es nur so, als wäre es lauwarm.“
- Vermischte oder widersprüchliche Empfindungen: Schmerzen und unangenehme Missempfindungen können auch gleichzeitig mit Taubheit in anderen Arealen auftreten.„Meine Hand ist ab hier taub, aber gleichzeitig brennt es dort drinnen wie Feuer.“
Typische Beschwerden aus Sicht Betroffener – Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen
Die folgenden Beispiele zeigen Auswirkungen von Empfindungs-, Verarbeitungs- und Integrationsstörungen in Verbindung mit Schmerzen. Die Zusammenhänge sind neurobiologisch plausibel und werden teils ähnlich beschrieben. Ein direkter kausaler Nachweis steht noch aus.
- Diskriminationsstörung: Das Gehirn kann Ort, Art oder Intensität von Reizen nicht mehr zuverlässig unterscheiden und richtig zuordnen.„Mein Therapeut berührt mein linkes Bein, aber dann tut die rechte Seite weh. Wenn er meine Hand berührt, spüre ich nicht, ob es ein leichter Druck oder ein kräftiger Griff ist.”
- Somatosensorische Gating-Störung: Das Gehirn kann eintreffende Reize nicht mehr filtern, um sie differenziert und geordnet zu verarbeiten. Reize überlagern sich, erscheinen diffus oder schwer einzuordnen.„Wenn nur meine Hand berührt wird, spüre ich das deutlich. Aber wenn gleichzeitig auch mein Arm berührt wird, ist es wie ein verschwommener Eindruck. Schwer zu sagen, wo genau ich was spüre.“
„Es ist, als würden mehrere Reize gleichzeitig aufeinanderprallen. Mein Gehirn bekommt das nicht sortiert, und dann fühlt sich alles einfach falsch an.“ - Astereognosie: Objekte können durch Tasten nicht mehr eindeutig erkannt oder sinnvoll genutzt werden, obwohl das Grundempfinden intakt ist.„Ich nehme einen Schlüssel in die Hand, aber ohne hinzusehen erkenne ich ihn nicht. Und manchmal habe ich sofort Schmerzen, wenn ich unbemerkt kräftiger zugreife.“
Diese Störungen können die Schmerzverarbeitung indirekt verstärken: beispielsweise durch Verunsicherung, Verlust der Körperzuordnung und falsche motorische Reaktionen oder stressbedingte Fehlregulationen. Wenn das Vertrauen in die eigene Körperwahrnehmung verloren geht, steigt die körperliche und emotionale Anspannung.
Die rehabilitationsmedizinische Sicht: Warum diese Beschwerden ernst zu nehmen sind
Auch wenn nicht alle neurophysiologischen Mechanismen vollständig erforscht und verstanden sind, lässt sich sagen: Das Thalamus-Schmerzsyndrom ist eine real erfahrbare, zentral bedingte Störung mit weitreichenden Auswirkungen auf Alltagsfunktionen, das Selbstbild und soziale Beziehungen.
Wenn Körperempfindungen widersprüchlich wahrgenommen werden, entsteht oft ein Gefühl von Misstrauen gegenüber dem eigenen Spüren. Viele berichten über das belastende Gefühl, ihrem Körper nicht mehr trauen zu können und fühlen sich dadurch im Alltag unsicher.
Dazu kommen die Unvorhersehbarkeit und Angst vor neuen Schmerzschüben. Eine erhöhte Erwartungsangst kann wiederum Schmerzen verstärken.
Auch im zwischenmenschlichen Bereich führt das zu Spannungen: Andere können oft nicht nachvollziehen, wie diffus und unberechenbar die Beschwerden sind.
Ein Betroffener schildert: „Ich greife nach der Tasse, aber ich spüre nicht, wie fest ich zudrücke. Und plötzlich tut es so weh, als würde mir jemand die Finger abklemmen. Da ist nichts, aber ich bilde mir den Schmerz doch nicht ein.“
Viele ziehen sich zurück, weil sie sich unverstanden fühlen. Oder sie meiden Kontakte, um sich vor Reizüberflutung und Überforderung zu schützen. Mit dem Risiko sozialer Isolation.
Funktionseinschränkungen hemmen zusätzlich die Aktivität. Bestimmte Tätigkeiten, selbst frühere Hobbys oder einfache alltägliche Aufgaben, werden aus körperlicher Beeinträchtigung, Vorsicht, Unsicherheit oder Angst vermieden.
Hier zeigt sich: Die Schmerzverarbeitung ist nicht nur eine Sache der Nervenschädigung. Sie wird ebenso durch Wahrnehmung, Stress, Bewegungskontrolle und den Umgang mit den eigenen Reaktionen beeinflusst.
Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, körperliche, psychische und soziale Reaktionen im individuellen Erleben gemeinsam zu betrachten. Lebensrealitäten und Teilhabemöglichkeiten werden immer systemisch durch person- und umweltbezogene Faktoren geprägt.
Was hilft: Orientierung statt Überforderung und ein stabiles „Trotzdem”
In der Therapie geht es nicht darum, schnell zur Normalität zurückzukehren, sondern sich im veränderten Körpererleben neu zu orientieren. Unter anderem helfen aufgabenorientierte, alltagsnahe Übungen sowie sensomotorisches Training dabei, Sinneseindrücke neu einzuordnen.
Dennoch sind hier Geduld und Verständnis gefragt, um Druck und unrealistische Erwartungen („Ich muss wieder so funktionieren wie früher“) zu vermeiden oder zu reduzieren. Dies gilt auch für das Umfeld, dem eine bedeutende Rolle in der unterstützenden Begleitung zukommt.
Der Wunsch, schmerzfrei oder angstfrei zu werden, ist verständlich. Doch manchmal erdrückt genau diese Hoffnung die Zuversicht, die aus kleinen Schritten entstehen kann. Rehabilitation bedeutet nicht nur funktionelles Training, sondern ebenso:
- sich selbst auch mit Einschränkungen wieder spüren zu lernen,
- informierte, stimmige Entscheidungen treffen zu können,
- bewusst zu erkennen, was trotz allem möglich ist.
Rehabilitationsprozesse bei zentralem Schmerz sind kein Sprint. Sie gleichen einem Marathon und manchmal auch einem Hindernislauf. Aber jeder Schritt zählt.
Fazit: Verstehen entlastet und schafft Handlungsspielraum
Das Thalamus-Schmerzsyndrom ist eine komplexe, aber erklärbare Folge eines Schlaganfalls im Thalamus. Es betrifft nicht nur das Nervensystem, sondern auch das Selbstgefühl, das Verhalten und den gesamten Alltag.
Je besser Betroffene und Angehörige die Zusammenhänge verstehen, desto eher lässt sich aus der Überforderung ein Umgang entwickeln, der entlasten und neue Perspektiven eröffnen kann.
Auf den Punkt erklärt: Warum ist der Schmerz so quälend?
Der Thalamus ist bei dem Schmerzsyndrom mit einem überlasteten Torwächter vergleichbar: Normalerweise lässt er nur relevante Signale durch (beispielsweise „Hand berührt heiße Herdplatte → Schmerz → Rückzug“).
Nach einem Infarkt drängen alle Signale ungefiltert ins Bewusstsein. Harmlose Reize (Bettdecke, Luftzug) werden als Bedrohung fehlinterpretiert.
Für Betroffene bedeutet das:
- Der Alltag wird zur Herausforderung: Selbst einfache Handlungen (Anziehen, Essen) können Schmerzen auslösen.
- Unvorhersehbarkeit: Die Symptome fluktuieren. Mal sind sie erträglich, mal überwältigend
- Therapie-Dilemma: Weil die Ursache zentral liegt, helfen klassische Schmerzmittel oft nicht. Ein multimodaler Ansatz (Physio- und Ergotherapie, Medikamente, Entspannungstechniken, Edukation, Psychotherapie und weitere Ansätze) ist nötig.
Mehr als nur Müdigkeit: Post Stroke Fatigue (PSF)
Nicht alle Folgen eines Thalamusinfarkts lassen sich den beschriebenen Empfindungs- oder Sensibilitätsstörungen zuordnen. Manche Phänomene betreffen stärker das allgemeine Befinden und die Belastbarkeit. Dazu gehört die Post Stroke Fatigue (PSF).
PSF unterscheidet sich von normaler Müdigkeit durch ihren anhaltenden, überwältigenden Charakter, dass sie durch Erholung nicht verschwindet und mit funktionellen Einbußen einhergeht. Dadurch kann sie den Alltag sowie die Lebensqualität erheblich einschränken.
Post Stroke Fatigue (PSF): eine besondere Form des Befindens
Viele Betroffene berichten nach einem Thalamusinfarkt über bleierne Müdigkeit oder starke Erschöpfung. Manche beschreiben sie ähnlich wie eine „Empfindungsstörung", jedoch handelt es sich fachlich nicht um eine Sensibilitätsstörung wie Kribbeln oder Taubheit.
Die Post Stroke Fatigue ist ein eigenständiges, komplexes Phänomen, das motorische, geistige und emotionale Bereiche betreffen kann. Typisch sind:
- anhaltende Müdigkeit, die durch Schlaf oder Ruhe nicht wesentlich besser wird,
- ausgeprägte Schwäche und schnelle Erschöpfung auch bei geringer Anstrengung,
- Probleme mit Konzentration, Motivation und körperlicher >Leistungsfähigkeit.
Grundsätzlich kann PSF nach jeder Art von Schlaganfall auftreten.
Als Ursache wird ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren beschrieben, und das zeigt sich auch im Verlauf:6
In der Akutphase muss das Gehirn Schäden reparieren und Funktionsverluste kompensieren, was viel Energie verbraucht. Später können anhaltende Entzündungen sowie psychische Belastungen wie Depressionen, Ängste oder soziale Einflüsse die Fatigue verstärken.
Müdigkeit nach einem Schlaganfall ist insgesamt häufig und auch als Begleitphänomen der neurologischen Anpassung zu verstehen. Eine ausgeprägte Post Stroke Fatigue entwickelt sich nicht bei allen, sondern betrifft schätzungsweise 40 bis 50 Prozent der Betroffenen.
Wann sollten Sie ärztlichen Rat einholen?
- Wenn die Müdigkeit dauerhaft über einen langen Zeitraum bestehen bleibt.
- Wenn Sie sich dadurch stark in Ihrem Alltag eingeschränkt fühlen.
Fragen und Antworten zu Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt
Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt: ein Zeichen der Heilung?
Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt sind häufig. Sie können sehr unangenehm sein und Betroffene stark verunsichern. Viele fragen sich deshalb: Sind solche Störungen normal? Oder weisen sie sogar auf Heilung hin?
Grundsätzlich gilt: Empfindungsstörungen sind nicht ungewöhnlich. Sie treten oft in der Phase der neurologischen Erholung auf und können mit Reparatur- und Anpassungsprozessen des Gehirns zusammenhängen.
Ein Blick auf die Funktion des Thalamus hilft wieder, die Beschwerden zu verstehen:
Der Thalamus spielt als zentrale Schaltstelle eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung verschiedenster Sinneseindrücke und Schmerzreize.
Wird diese Region durch einen Infarkt geschädigt, kann diese Verarbeitung beeinträchtigt sein. Mit der Folge von Empfindungsstörungen wie Taubheit, Kribbeln, Brennen oder anderen Missempfindungen.
- Taubheit ist meist Ausdruck einer ausgefallenen Empfindung und eine direkte Folge der Schädigung.
- Kribbeln, Brennen oder Schmerzen hingegen deuten darauf hin, dass das Nervensystem weiterhin Signale weiterleitet. Manchmal übersteigert oder fehlerhaft.
Warum können verstärkte Empfindungen ein Hinweis auf Reparatur- und Genesungsprozesse sein? Das Gehirn ist kein statisches Organ, sondern sehr anpassungsfähig und regenerationsfähig. Durch die sogenannte Neuroplastizität reorganisiert es nach Schädigungen seine Netzwerke: Verbindungen werden geschwächt oder aufgelöst, neue aufgebaut und beschädigte Bahnen neu verschaltet.
Während dieser Reorganisation können vorübergehend fehlerhafte oder verstärkte Signale entstehen, die Betroffene als Missempfindungen wahrnehmen. Sie resultieren aus anhaltenden Entzündungs- und Umbauprozessen im Gehirn, die infolge des Infarkts ausgelöst werden.
Die veränderten Empfindungen sind daher nicht nur Zeichen einer Störung, sondern auch Hinweise darauf, dass das Gehirn aktiv daran arbeitet, sich zu heilen und Funktionen wiederherzustellen.
Können Empfindungsstörungen nach einiger Zeit erneut auftreten?
Ja, das ist möglich. Die Erholung des Nervensystems nach einem Thalamusinfarkt ist ein langwieriger Prozess. Dieser kann sich über Monate und Jahre erstrecken. Dabei gibt es Phasen, in denen die Empfindungsstörungen subjektiv als schwächer wahrgenommen werden, vorübergehend ganz verschwinden oder auch wieder stärker auftreten.
Typische Verlaufsmuster sind:
- Besserung: Missempfindungen nehmen ab oder verschwinden zeitweise
- Stagnation: Beschwerden bleiben auf gleichem Niveau, trotz Therapie und Reha weiterleitet. Manchmal übersteigert oder fehlerhaft.
- Rückschritte: Symptome verstärken sich oder neue Empfindungsstörungen treten auf.
Diese Schwankungen sind Teil des natürlichen Heilungsprozesses und spiegeln die fortlaufende Anpassung und Neuorganisation des Gehirns wider. Vor allem nach körperlicher Belastung können aufflackernde Missempfindungen oder Schmerzen auftreten. Bis zu ein Viertel der Betroffenen entwickelt allerdings im Verlauf ein Thalamus-Schmerz-Syndrom, bei dem die typischen Beschwerden chronisch werden.
In den ersten drei bis sechs Monaten nach dem Thalamusinfarkt sind die Umstrukturierungsprozesse im Gehirn am umfangreichsten. Deshalb kann die funktionelle Regeneration durch intensives Training in diesem Zeitraum besonders effektiv unterstützt werden.
Doch auch wenn die Neuorganisation der Nervenverbindungen durch die Neuroplastizität mit der Zeit nachlässt, sind zwei Jahre nach dem Thalamusinfarkt noch deutliche subjektive Verbesserungen möglich. Funktionseinschränkungen können auch weiterhin teilweise kompensiert werden.
Dabei ist jedoch zu keinem Zeitpunkt absehbar, ob eine Person dauerhaft durch den Infarkt beeinträchtigt bleibt. Auch das Ausmaß der bleibenden Beeinträchtigungen ist ungewiss. Trotz Unsicherheiten ist es dennoch wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren und auch unangenehme Missempfindungen als Zeichen des Fortschritts und der Genesung annehmen zu können.
Wann sollten Empfindungsstörungen ärztlich abgeklärt werden?
Empfindungsstörungen sollten ärztlich untersucht werden, wenn sich ihre Art, Häufigkeit, Ausprägung oder Intensität deutlich verändert.
Neu auftretende Missempfindungen sind keine unmittelbare Alarmmeldung und sollten keine Angst auslösen. Sie sollten jedoch immer ernst genommen und neurologisch abgeklärt werden.
Wann sollten Sie mit Empfindungsstörungen einen Arzt aufsuchen?
Besprechen Sie Ihre Empfindungsstörungen mit einer Neurologin oder einem Neurologen, wenn:
- sich die Qualität ihrer Missempfindung ändert (zum Beispiel, wenn aus einem Kribbeln plötzlich Schmerzen werden).
- Ihre Empfindungsstörung sich zwar qualitativ nicht ändert, jedoch deutlich häufiger auftritt
- Ihre Missempfindung ursprünglich nur auf einen bestimmten Bereich Ihres Körpers begrenzt war (zum Beispiel den rechten Arm) und sich nun auf weitere Körperbereiche ausweitet (beispielsweise Ihre gesamte rechte Körperhälfte)
- Sie zunächst nur ein leichtes Kribbeln verspüren (vergleichbar mit einer Ameise, die über die betroffene Stelle läuft), das dann in ein sehr starkes Kribbeln (vergleichbar mit Nadelstichen) übergeht
- neue Missempfindungen auftreten, zum Beispiel wenn zum Kribbeln im rechten Arm ein Taubheitsgefühl um den Mund hinzukommt.
- neben den Empfindungsstörungen weitere neue Symptome auftreten. Diese können auf einen erneuten Schlaganfall hinweisen
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Das ermöglicht die frühzeitige Einleitung einer geeigneten Behandlung.
Den Heilungsprozess fördern und Empfindungsstörungen lindern
Da der Thalamus vielfältige sensorische Informationen verarbeitet, können nach einem Thalamusinfarkt Empfindungsstörungen in unterschiedlichen Qualitäten und in mehreren Körperregionen auftreten. Die Erholung des Nervensystems verläuft jedoch individuell unterschiedlich. Sowohl in der Art der Empfindungen als auch in deren Rückgang.
Es gibt vielfältige Therapieansätze und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, um die Genesung zu unterstützen und Beschwerden zu lindern. Nicht alle Verfahren sind wissenschaftlich gleichermaßen belegt, und ihre Wirkung kann von Person zu Person variieren. Idealerweise sollte die Behandlung von Empfindungsstörungen Teil eines umfassenden neurorehabilitativen Gesamtkonzepts sein.
Viele Betroffene profitieren davon, wenn sie verschiedene Methoden schrittweise ausprobieren und sich dabei therapeutisch begleiten lassen, um herauszufinden, was individuell am besten hilft.
In der Praxis haben sich ergänzend zu diesem Artikel über Empfindungsstörungen nach einem Schlaganfall vor allem folgende Ansätze bewährt:
Somatosensorische Stimulation
Gezielte sensorische Reize können die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems unterstützen und die Wahrnehmung betroffener Körperregionen fördern. Dabei geht es nicht nur um das „Wecken“ der Sensibilität, sondern auch um die Schulung der Diskriminationsfähigkeit, also die Fähigkeit, unterschiedliche Reize zu unterscheiden und zuzuordnen.
Bei schmerzhaften Missempfindungen wie Hyperästhesie, Allodynie und zentralem Schmerzsyndrom ist jedoch Vorsicht geboten, da selbst taktile Reize zu einer Schmerzverstärkung führen können. Die Stimulation sollte daher stets nach subjektivem Befinden, in ärztlich-therapeutischer Rücksprache und schrittweise steigend erfolgen. Und in diesem Fall geht es eher um eine „Re-Kalibrierung der Diskriminationsfähigkeit“: Das Nervensystem soll lernen, zwischen ungefährlich und bedrohlich zu unterscheiden.
Bei schmerzhaften Empfindungsstörungen ist es auch angemessener, von Desensibilisierungstraining oder graduierter sensorischer Exposition, nicht von „Reiztraining“ zu sprechen.
Selbst ohne Überreizung Grenzen austesten
Ein behutsames Vorgehen kann helfen, Überreizung zu vermeiden und die Toleranzgrenzen langsam zu erweitern:
- Beginnen Sie auf der nicht betroffenen Seite mit sanften Berührungen, um das Empfinden zu orientieren.
- Tasten Sie sich dann vorsichtig an die betroffene Seite heran, um herauszufinden, welche Reize angenehm oder zumindest tolerabel sind (etwa Watte, weicher Frottee-Waschlappen, Handtuch, Massagehandschuh oder weiche Bürste).
- Wenn es verträglich ist, reiben Sie die betroffene Körperregion mit verminderter Sensibilität regelmäßig mit einem Massagehandschuh, einem trockenen Frottee-Waschlappen oder anderem ab.
Diese Reize können helfen, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zu fördern und das Körperempfinden zu stabilisieren. In der Therapie werden solche passiven sensorischen Stimuli häufig mit aktiven Bewegungs- und Funktionsübungen kombiniert, um die motorische Kontrolle und Alltagsfunktionen zu unterstützen.
Realistische Erwartungen sind wichtig: Häufig zeigen sich Fortschritte nicht durch ein direktes „Zurückkehren“ der Sensibilität, sondern durch die allmähliche sensomotorische Integration, also das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewegung und Alltagsfunktion.
Anwendungen mit Wärme, Kälte und Wasser
Thermische Anwendungen wie Wärmepackungen oder Kälteumschläge sowie wechselwarme Teilbäder können die Durchblutung und Muskelentspannung fördern und Schmerzen lindern.
Für ihre Wirksamkeit nach einem Schlaganfall und speziell nach einem Thalamusinfarkt liegen bisher nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen vor. Dennoch berichten viele Betroffene, dass solche Anwendungen ihr Wohlbefinden verbessern und Symptome subjektiv erleichtern.
Elektrotherapie
Zur Linderung von Schmerzen und Missempfindungen nach einem Thalamusinfarkt können unterschiedliche Elektrotherapie-Verfahren eingesetzt werden.
Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) wird in der Praxis häufig eingesetzt, üblicherweise aber nicht isoliert, sondern als Therapiebaustein.
Das Grundprinzip ist Folgendes: TENS aktiviert körpereigene schmerzhemmende Mechanismen (zum Beispiel Endorphine) und blockiert die Weiterleitung schmerzhafter Signale im Nervensystem. Dabei werden über Elektroden schwache Stromimpulse auf die Haut abgegeben, die Nervenfasern stimulieren und die Schmerzverarbeitung im Rückenmark beeinflussen.
Die Wirksamkeit von TENS wird in Studien insgesamt als eher gering bis moderat bewertet.6,7
Für das zentrale Schmerzsyndrom nach Schlaganfall, wie es nach Thalamusinfarkt auftreten kann, ist die Evidenz schwach und die Datenlage begrenzt. Da TENS jedoch ein sicheres und gut verträgliches Verfahren ist und sich zur Heimanwendung eignet, kann es individuell sinnvoll sein, es auszuprobieren. Immer in Absprache mit Fachpersonen und unter fachlicher Anleitung.
Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) und transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) sind weitere experimentelle Ansätze, die die Erregbarkeit der Großhirnrinde und die Schmerzmodulation beeinflussen.21 Erste Studien zeigen Hinweise auf Wirksamkeit, jedoch lassen sich daraus noch keine Empfehlungen ableiten.
Physiotherapie und Ergotherapie
In der Schlaganfall-Rehabilitation sind Physiotherapie und Ergotherapie zentrale Elemente, bei denen unterschiedliche Ansätze zum Einsatz kommen. Sie wirken nicht nur auf die Motorik, sondern auch auf die sensorische Verarbeitung.
Durch gezielte Übungen lernen Betroffene, Berührung, Temperatur oder Druck wieder bewusster und mit weniger Beschwerden wahrzunehmen und diese Eindrücke in Bewegungen umzusetzen.
Funktionalität und Lebensqualität zurückgewinnen
Studien zeigen, dass hochfrequente, intensive und aufgabenorientierte Übungen mit vielen Wiederholungen die Neuroplastizität fördern und somit die funktionelle Erholung nach Schlaganfall unterstützen.10,18 Dabei kann propriozeptives Training (unter anderem Übungen zur Körperwahrnehmung) in Kombination mit Dual-Tasking unter Alltagsbedingungen besonders wirksam sein.9
Dual-Tasking bedeutet, zwei Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Zum Beispiel beim Gehen einen Ball balancieren und dabei Zahlen nennen. Solche Übungen verbinden Bewegung, Aufmerksamkeit und sensorische Stimulation. Regelmäßiges Training hilft den Betroffenen dadurch, Empfindungsstörungen bei täglichen Aktivitäten besser zu bewältigen.
Diese Ansätze sind nach einem Thalamusinfarkt relevant. Denn sie zielen auch auf die sensorische Integration und die Kompensation von Empfindungsstörungen ab, indem sie die parallele Verarbeitung von Reizen trainieren. Individuell bedeutsame, funktionelle Ziele zu setzen (zum Beispiel „Ich möchte im Stehen wieder sicher meine Kaffeetasse halten“), unterstützt die Motivation und kann den Transfer in den Alltag fördern.
Zudem hat kardiorespiratorisches Fitnesstraining nach einem Schlaganfall positive Effekte auf Ausdauer, Belastbarkeit und Lebensqualität8 und damit auch auf die Bewältigung von Empfindungsstörungen. Gerade beim Thalamus-Schmerzsyndrom, das oft mit Fatigue und emotionaler Belastung einhergeht, kann ein moderates Ausdauertraining (beispielsweise Gehen, Radfahren mit Anpassungen) helfen, die körperliche und psychische Resilienz zu stärken.

Möglichkeiten zur Förderung des Heilungsprozesses nach einem Thalamusinfarkt (Beispiele):
Elektrotherapie, Physio- und Hydrotherapie können bei Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt in Kombination mit einem multimodalen Therapiekonzept unterstützend wirken. Behandlungsoptionen sind außerdem: sensorische Stimulation, Ergotherapie, Psychotherapie, Entspannungsübungen sowie Medikamente. Sie können zur Linderung der Missempfindungen beitragen. Die Grafik zeigt eine Auswahl.
Bewegungsqualität und Schmerzmanagement verbessern
In der Praxis hat es sich bewährt, in das Übungsprogramm sanfte, kontrollierte Bewegungen zu integrieren. Sie können ergänzend unterstützen, neue Bewegungsmuster und harmonische Bewegungsabläufe zu festigen sowie Überlastungen zu vermeiden.
Spezielle Handgriffe, beispielsweise aus dem Bobath-Konzept bei Thalamus-Schmerzsyndrom, tragen außerdem dazu bei, den häufig erhöhten Muskeltonus zu regulieren. Wenn sich die Anspannung löst, können Schmerzattacken nach und nach durchaus reduziert werden.
Auch die Spiegeltherapie kann beim Thalamus-Schmerzsyndrom helfen, besonders bei verzerrter Körperwahrnehmung oder phantomartigen Schmerzen.
Alltagskompetenz und Selbstständigkeit fördern
Während Physiotherapie vor allem Bewegungsabläufe, Kraft und Koordination trainiert, zielt die Ergotherapie darauf ab, diese Fähigkeiten in konkrete Alltagsaktivitäten zu übertragen. Besonders bei Empfindungsstörungen nach Thalamusinfarkt üben Betroffene zum Beispiel:
- das sichere Greifen von Gegenständen trotz Taubheit, Treppensteigen bei Kribbeln in den Füßen oder ein anderes Anziehen von Kleidung, wenn Berührungen schmerzhaft sind
- präventive Schutzstrategien und neue Bewegungsmuster, wenn Schmerzreize vermindert wahrgenommen werden (unter anderem durch visuelle Kontrolle)
- die Anpassung des Umfelds (zum Beispiel rutschfeste Matten, ergonomische Hilfsmittel)
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten dabei eng mit den Betroffenen zusammen, um ganz individuelle Lösungen für den Alltag zu entwickeln. Und was noch nicht möglich ist, gelingt manchmal auf andere Weise durch kompensatorische Techniken oder das Training von Ersatzstrategien.
Medikamentöse Behandlung
Bei starken Missempfindungen und zentralen Schmerzen ist eine individuell abgestimmte medikamentöse Behandlung oft unverzichtbar.
Die Wahl der Medikamente richtet sich nach den zugrunde liegenden zentralen Schmerzmechanismen, die durch die Schädigung thalamischer und kortikaler Strukturen entstehen. Außerdem sind Nebenerkrankungen sowie begleitende aktuelle Beschwerden unabhängig von Thalamusinfarktfolgen zu berücksichtigen.
So können die Wirkstoffe, einzeln oder kombiniert verordnet, etwa auf die Übererregbarkeit geschädigter Nervenzellen, die Fehlinterpretation normaler Reize als Schmerz oder auf eine gestörte Neurotransmitter-Balance abzielen.
Daneben ist es wichtig, auch Schlafstörungen, Depressivität oder Angst sowie andere Symptome bei Leidensdruck zu behandeln.
Eingesetzte Wirkstoffe bei zentralen Schmerzen (leitlinienorientierte Auswahl):
-
- Antikonvulsiva wie Pregabalin oder Gabapentin (eher weniger) dämpfen die übermäßige Erregung im Thalamus und können vor allem brennende Schmerzen und Missempfindungen modulieren.
- Antidepressiva wie Amitriptylin (trizyklisch) oder Duloxetin (SSNRI) verstärken die körpereigenen schmerzhemmenden Systeme und wirken zusätzlich auf begleitende Depressionen oder Ängste.
- Lamotrigin wird seltener eingesetzt, kann aber bei therapierefraktären Fällen versucht werden, da es die Freisetzung schmerzverstärkender Botenstoffe hemmt.
- Opioide kommen nur bei schweren, anders nicht behandelbaren Schmerzen infrage.
- NMDA-Antagonisten wie Ketamin wirken auf glutamaterge Schaltstellen (NMDA-Rezeptoren) und können – richtig eingesetzt – über eine kurzzeitige Unterbrechung der Schmerzschleifen hinaus die zentrale Schmerzverarbeitung modulieren. Ihr Einsatz bleibt bislang experimentellen oder individuellen Heilversuchen vorbehalten. Die Studienlage ist uneinheitlich, jedoch existieren Einzelfallberichte und kleine Serien, in denen bei therapierefraktären Verläufen eine vorübergehende Linderung oder verbesserte Reizregulation beschrieben wurde.10,21
Oft ist ein Ausprobieren nötig, da Menschen unterschiedlich auf Medikamente ansprechen. Aufgrund möglicher Nebenwirkungen (unter anderem häufig: Müdigkeit, Schwindel, Konzentrationsstörungen oder emotionale Veränderungen), potenzieller Wechselwirkungen und notwendiger Verlaufskontrollen - teils mit Laboruntersuchungen - sollte die Behandlung unter spezialfachärztlicher Begleitung erfolgen. Ideal ist eine interdisziplinäre Betreuung mit schmerztherapeutischer, neurologischer und psychiatrischer Erfahrung beim zentralen Schmerzsyndrom.
Grenzen der Pharmakotherapie
Medikamente allein reichen meist nicht aus, um komplexe Beschwerden wie zentral bedingte Missempfindungen oder chronische Schmerzen zu beherrschen. Sie sind jedoch ein wichtiges Element eines multimodalen Behandlungskonzepts in der Neurorehabilitation.
Dazu zählen im Idealfall auch Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Edukation und Sozialberatung.
Wichtig sind ebenso Lebensstil-, Arbeitsgestaltungs- und Umfeldanpassungen sowie soziale Beziehungen und unterstützende Strukturen. So kann der Transfer von effektiven Schmerz- und Krankheitsverarbeitungsstrategien in den Alltag nachhaltig unterstützt werden.
Die Behandlung des Thalamus-Schmerzsyndroms bleibt eine große Herausforderung. Kontrollierte Studien zu neuen Therapieansätzen und eine systematische Erfassung patientenrelevanter Ergebnisse sind dringend nötig, um die Versorgung zu verbessern.
Einen fachlichen Beitrag und Austausch zum Thema „Neuropathie nach Schlaganfall - zentraler Schmerz nach Thalamusinfarkt" finden Sie auch in unserem Selbsthilfe-Forum.
Entspannung und Stressbewältigung
Stress kann Empfindungsstörungen und Schmerzen verstärken. Entspannungstechniken helfen, das Nervensystem zu beruhigen, die Schmerzverarbeitung zu regulieren und den Schlaf zu verbessern. Besonders hilfreich können sein:
- Spezielle Atemübungen:Sie senken die Anspannung, fördern die Sauerstoffversorgung und unterstützen innere Ruhe.
- Autogenes Training: Durch Selbstsuggestion wird der Körper in einen Zustand tiefer Entspannung versetzt. Das kann die Intensität von Empfindungsstörungen und Schmerzen dämpfen.
- Progressive Muskelentspannung: Das bewusste An- und Entspannen von einzelnen Muskelgruppen hilft, Spannungszustände zu lösen, die Missempfindungen verstärken können.
- Yoga: Eine Kombination aus Bewegung, Atmung und Achtsamkeit kann die Körperwahrnehmung verbessern und die emotionale Regulation stärken.
- Biofeedback: Mit Hilfe technischer Geräte, etwa zur Messung von Muskelspannung, Hautleitfähigkeit oder Herzfrequenz, werden unbewusste Körperreaktionen sichtbar gemacht. Betroffene lernen somit, diese gezielt zu beeinflussen. Gerade bei zentralen Empfindungsstörungen kann Biofeedback helfen, Übererregung zu reduzieren und die Kontrolle über Körperempfindungen zurückzugewinnen.
Studien zeigen, dass EMG-Biofeedback insbesondere die motorische Funktion unterstützt und in Kombination mit weiteren Therapien die Schmerzsymptomatik bei Thalamusinfarkt verbessern kann.11,12
Während der direkte Einfluss auf sensorische Empfindungsstörungen noch wenig untersucht ist, kann Biofeedback zur Verbesserung der Gesamtwahrnehmung und Kontrolle des Körpers beitragen.
Testen Sie heilungsfördernde Methoden einzeln und gezielt!
- Führen Sie Ihren Körper langsam an unterschiedliche Möglichkeiten heran, die den Genesungsprozess fördern können.
- Versuchen Sie, geduldig zu sein und nicht auf zu viel gleichzeitig zu setzen, denn das würde Ihren Körper eher überfordern.
- Nicht alle Methoden helfen jedem Menschen gleichermaßen. Empfindungsstörungen sind sehr individuell.
- Indem Sie Schritt für Schritt verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, können Sie herausfinden, was Ihnen wirklich hilft. Das Motto „Viel hilft viel” ist hier oft fehl am Platz!
Langfristige Förderung der Genesung nach einem Thalamusinfarkt
Das Ausprobieren direkt heilungsfördernder Methoden und Anwendungen zur Linderung der Empfindungsstörungen ist ein guter Anfang. Die langfristige und nachhaltige Förderung der Genesung ist jedoch weitreichender.
Um Empfindungsstörungen dauerhaft zu behandeln und einem weiteren Schlaganfall vorzubeugen, bedarf es:
- der regelmäßigen Kontrolle und Einstellung von Risikofaktoren, beispielsweise Bluthochdruck
- Anpassungen des Lebensstils, zum Beispiel durch mehr Bewegung oder eine Ernährungsumstellung
- regelmäßiger Verlaufskontrollen durch Fachärztinnen und -ärzte
So fördern Sie nachhaltig Ihre Genesung
- Achten Sie auf einen regelmäßigen und erholsamen Schlaf, zum Beispiel durch feste Schlafzeiten und positive Schlafrituale. Tun Sie, was Sie vor dem Schlafen entspannt. Genießen Sie beispielsweise eine Tasse Ihres Lieblingstees, während Sie die Ereignisse des Tages kurz in einem Tagebuch niederschreiben. So können Sie den Tag besser loslassen. Ein guter Schlaf beruhigt das Nervensystem und kann daher zur Linderung der Empfindungsstörungen beitragen.
- Ernähren Sie sich vielseitig und ausgewogen. Mit einer gesunden Ernährung können Sie einige Schlaganfall-Risikofaktoren deutlich verbessern und Ihren gesamten Genesungsprozess fördern.
- Integrieren Sie regelmäßige Bewegungseinheiten in Ihren Alltag. Regelmäßige moderate Bewegung kann Ihre Missempfindungen verbessern und fördert Ihr gesamtes Wohlbefinden. Darüber hinaus kann auch Bewegung zu einer Verbesserung Ihrer Risikofaktoren beitragen.
- Strukturieren Sie Ihren Alltag nach Ihren Bedürfnissen. Schaffen Sie sich eine für Sie als angenehm empfundene Balance zwischen Aktivität und Ruhepausen.
- Fördern Sie auch Ihre geistige Aktivität. Sie können beispielsweise einem kreativen Hobby wie dem Malen nachgehen oder regelmäßig Denksportaufgaben lösen. Auch das Erlernen einer neuen Sprache regt Ihre geistige Aktivität an.
- Teilen Sie sich Ihre Energie bewusst ein. Ein Körper mit „leeren Akkus” kann nicht gut genesen. Seien Sie aktiv, aber respektieren Sie Ihre eigenen Grenzen. Hören Sie auf Ihren Körper und legen Sie rechtzeitig und ausreichende Ruhepausen ein.
- Steuern Sie negativem Stress bewusst entgegen. Lernen Sie, Stress bewusst zu erkennen und ihn rechtzeitig zu regulieren. Zur Stressreduktion eignen sich verschiedene Methoden und Techniken, beispielsweise bewusste Atemübungen. Vermeiden Sie vor allem zu hohe Erwartungen an Ihre Genesung. Das baut Druck auf und erschwert letztlich die Heilung.
- Bleiben Sie offen für Neues. Auch wenn es schwer fällt: Es hilft, die neue Situation anzunehmen. Akzeptieren bedeutet nicht, die Hoffnung aufzugeben oder mit den gegebenen Umständen einverstanden zu sein. Aber es öffnet den Blick für Realitäten, um über das Gewohnte hinaus zu denken. Es eröffnet neue Horizonte und unterstützt Sie dabei, Ihren Alltag an Ihre individuellen Umstände und Bedürfnisse anzupassen.
- Holen Sie sich professionelle Hilfe ins Boot. Ein enger und direkter Austausch mit ärztlichen und therapeutischen Fachpersonen ermöglicht die Entwicklung realistischer Ziele. Erarbeiten Sie gemeinsam Schritt für Schritt Lösungswege, damit Sie auch mit Ihren aktuellen Einschränkungen selbständig, aktiv und selbstbestimmt Ihren Alltag gestalten können. Auch das angeleitete Erlernen von Bewältigungsstrategien – das Coping und eine umfassende Aufklärung über Ihre Erkrankung tragen dazu bei.
Schlaganfall-Forum: Austausch mit anderen Betroffenen
Ein Selbsthilfe-Forum bietet eine hervorragende Möglichkeit zum Austausch mit anderen Betroffenen.
Doch wie trägt dieser Austausch zur Genesung bei?
Durch den direkten Austausch spüren Betroffene, dass sie nicht alleine mit ihren gesundheitlichen Sorgen sind. Sie erfahren Hilfsbereitschaft, Unterstützung und Verständnis und wachsen nicht selten zu einer echten Gemeinschaft zusammen. All das trägt dazu bei, dass Betroffene ihre Beeinträchtigungen besser verstehen und annehmen können.
Die Mitgliedschaft in einem Selbsthilfe-Forum erlaubt neue Blickwinkel und Sichtweisen. Durch den Austausch ergeben sich nicht selten neue Möglichkeiten. Auch erfahren Betroffene unter Umständen von Behandlungsmöglichkeiten, die Ihnen bislang unbekannt waren.
Aus diesem Grund kann auch die Mitgliedschaft in einem Schlaganfall-Forum als sozialer Unterstützungsfaktor den Genesungsprozess fördern.
Gesundheits-Tagebuch und Gesundheits-App
Um die Entwicklung der Empfindungsstörungen nachvollziehen zu können, kann ein Gesundheits-Tagebuch oder eine Gesundheits-App hilfreich sein. Hier können Symptome festgehalten werden und wie sie sich verändern.
Betroffene erkennen so leichter, welche Anwendungen ihnen geholfen haben und welche Faktoren möglicherweise Einfluss nehmen. Ärzte und Therapeuten können den Krankheitsverlauf jederzeit rückwirkend nachvollziehen und die Behandlung individuell daran anpassen.
Für Betroffene sind Gesundheits-Tagebücher und Gesundheits-Apps eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst zu motivieren. Eigene Fortschritte schwarz auf weiß zu sehen, kann das Durchhaltevermögen und die Zuversicht stärken, um weiter aktiv an der Verbesserung der Missempfindungen zu arbeiten.
Zusammenfassung
Empfindungsstörungen nach einem Thalamusinfarkt sind vielfältig und können sich im Alltag sehr belastend auswirken.
Charakteristisch ist, dass mehrere somatosensorische Modalitäten der Oberflächen- und Tiefensensibilität betroffen sind. Beschwerden wie Missempfindungen oder Schmerzen entstehen dabei nicht nur durch eine veränderte Empfindung, sondern auch durch Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung.
Der Thalamus spielt dabei eine entscheidende Rolle: Er filtert, gewichtet und integriert Sinneseindrücke. Wird dieser Filtermechanismus gestört, werden Reize unscharf, falsch priorisiert oder überlagern sich.
Darum erscheint die Symptomatik oft diffus, fluktuierend und belastungsabhängig, aber sie wirkt auch paradox. Die Folgen eines Thalamusinfarktes sind komplex - und das erklärt auch, warum ein multimodaler Behandlungsansatz erforderlich ist.
In vielen Fällen sind Empfindungsstörungen jedoch auch ein Zeichen der Genesung durch aktive Anpassungs- und Reparaturprozesse: Das Gehirn nutzt seine Neuroplastizität, um neue Nervenverbindungen auszubilden und die Funktion der Nervenzellen zu ersetzen, die durch den Schlaganfall geschädigt wurden. Dieser Prozess wird oft in unangenehmen Missempfindungen spürbar. Nicht immer sind Empfindungsstörungen allerdings klar zu beschreiben.
Mit Geduld, verschiedenen Therapieansätzen und unterstützenden Maßnahmen lassen sich die Beschwerden häufig lindern und besser annehmen.
Ein strukturierter Alltag, professionelle Begleitung und der Austausch mit anderen Betroffenen können dabei helfen, den Heilungsweg zu erleichtern. Eine Herausforderung und ein Handlungsfeld für weitere Forschung bleibt jedoch insbesondere die Behandlung des Thalamus-Schmerzsyndroms.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Empfindungsstörungen nach einem Schlaganfall
- Schlaganfall mit Thalamus-Schmerz-Syndrom
- Einfluss schlaganfallbedingter Emfindungsstörungen auf Sex
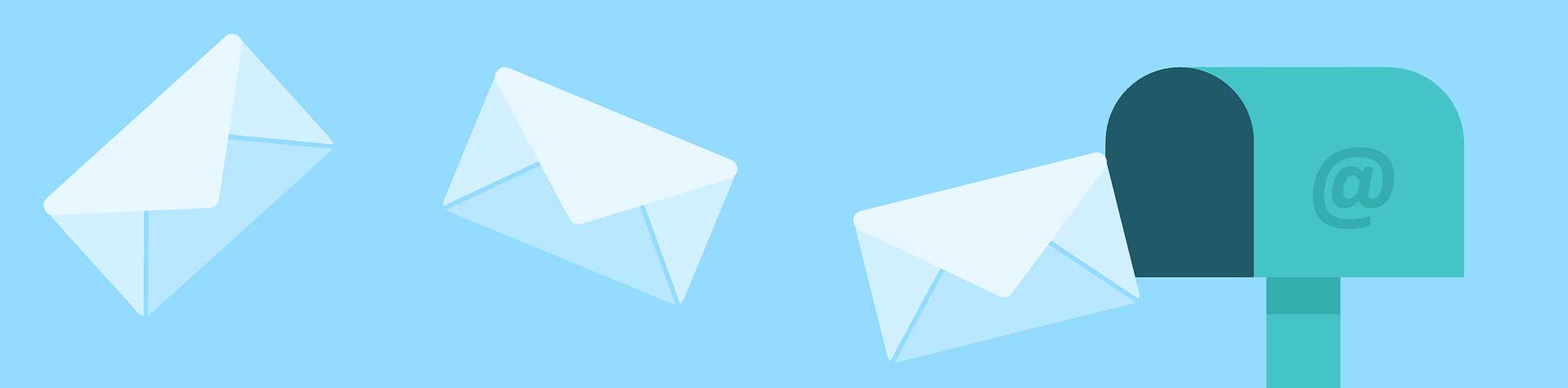
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autorin
unter Mitarbeit von Dipl.-Biol. Claudia Helbig
Dr. med. Karin Kelle-Herfurth, MHBA ist selbständige Beraterin in Hamburg. Sie begleitet Solo-Selbständige und Menschen in Führung nach Krankheit in der Neuausrichtung und berät zu gesunder Lebens- und Unternehmensführung. Als Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin liegt ihr Fokus in der Prävention und beruflichen Rehabilitation. Dies verknüpft sie als Gesundheitsökonomin mit dem Blick auf neue Arbeitskonzepte und Organisationsstrukturen im digitalen Zeitalter. [mehr]
Quellen
- Pschyrembel Klinisches Wörterbuch; 266. aktualisierte Auflage; 2014 - Autoren: Willibald Pschyrembel; Ulrike Arnold - Publikation: Walter de Gruyter & Co. Verlag; Berlin - ISBN: 978-3-11-033997-0
- Isolated facial sensory loss due to thalamic lacunar infarction - Autoren: Adrià Arboix; Cristina Tello; Elisenda Grivé; María-José Sánchez - Publikation: Acta Neurol Belg. 2016;116(4):651-653 - DOI: 10.1007/s13760-015-0581-2
- Pure sensory syndromes and post-stroke pain secondary to bilateral thalamic lacunar infarcts: a case report - Autoren: Karl B. Alstadhaug; Jan F. Prytz - Publikation: J Med Case Rep. 2012;6:359. Published 2012 Oct 24 - DOI: 10.1186/1752-1947-6-359
- A case report: Numb Chin Syndrome due to thalamic infarction: a rare case - Autoren: Florian Rimmele; Henning Maschke; Annette Großmann; Tim P. Jürgens - Publikation: BMC Neurol. 2019;19(1):303. Published 2019 Nov 29 DOI: 10.1186/s12883-019-1525-x
- Central poststroke pain: A systematic review. - Autoren: J. Singer; A. Conigliaro; E. Spina; S. W. Law; S. R. Levine - Publikation: Int J Stroke. 2017 Jun;12(4):343-355 - DOI: 10.1177/1747493017701149
- Post-stroke fatigue: a review of development, prevalence, predisposing factors, measurements, and treatments. - Autoren: W. Chen; T. Jiang; H. Huang; J. Zeng - Publikation: Frontiers in Neurology. 2023;14:1298915. - DOI: 10.3389/fneur.2023.1298915
- Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for neuropathic pain - Autoren: W. Gibson; B. M. Wand; N. O’Connell - Publikation: Cochrane Database Syst Rev. 2017;2017(9):CD011976 - DOI: 10.1002/14651858.CD011976.pub2
- Physical fitness training for stroke patients - Autoren: Saunders DH; Sanderson M; Hayes S; Johnson L; Kramer S; Carter DD; Jarvis H; Brazzelli M; Mead GE - Publikation: Cochrane Database Syst Rev. 2020;3:CD003316 - DOI: 10.1002/14651858.CD003316.pub7
- Proprioceptive and Dual‑Task Training: The Key of Stroke Rehabilitation, A Systematic Review - Autoren: R. Chiaramonte ; M. Bonfiglio ; P. Leonforte; G. L. Coltraro; C. S. Guerrera; Vecchio M. - Publikation: Journal of Functional Morphology and Kinesiology. 2022;7(3):53 - DOI: 10.3390/jfmk7030053
- S3-Leitlinie Schlaganfall – Rehabilitation, Therapie und Nachsorge - Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN), Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) - AWMF-Registernummer 030-125, 2020 - URL: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-125.html
- Electromyographic (EMG) Biofeedback in the Comprehensive Treatment of Central Pain and Ataxic Tremor Following Thalamic Stroke - Autoren: C. L. Edwards; S. Sudhakar; M. T. Scales; K. L. Applegate; W. Webster; R. H. Dunn - Publikation: Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2000;25(4):229–240 - DOI: 10.1023/A:1026406921765
- Electromyographic biofeedback therapy for improving limb function after stroke - Autoren: R. Wang; S. Zhang; J. Zhang; Q. Tong; X. Ye; K. Wang; et al. - Publikation: PLOS ONE. 2024;19(1):e0289572 - DOI: 10.1371/journal.pone.0289572
- Thalamic infarcts: clinical syndromes, etiology, and prognosis - Autoren: J. Bogousslavsky; F. Regli ; A.Uske - Publikation: Neurology. 1988 Jun;38(6):837-48 - DOI: 10.1212/wnl.38.6.837
- Topographic Mapping of Isolated Thalamic Infarcts Using Vascular and Novel Probabilistic Functional Thalamic Landmarks - Autoren: M. Rauch; J. R. Schüre; F. Lieschke; F. Keil; E. Steidl; S. J. You; C. Foerch; E. Hattingen; S. Weidauer; M. A. Schaller-Paule - Publikation: Clin Neuroradiol 2023, 33(2), 435–444 - DOI: 10.1007/s00062-022-01225-3
- Anteromedian, central, and posterolateral infarcts of the thalamus: three variant types - Autoren: E. Carrera; P. Michel; J. Bogousslavsky - Publikation: Stroke. 2004 Dec;35(12):2826-31 - DOI: 10.1161/01.STR.0000147039.49252.2f
- Pure thalamic infarctions: Clinical findings. - Autoren: Kumral E, Evyapan D, Kutluhan S. - Publikation: Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2000;9(6):287–297. - DOI: 10.1053/jscd.2000.18741
- Pure Thalamic Infarct: 8-Year Follow-Up Study in a Hospital in China. - Autoren: Liang H, Sarma AK, Wang Z, Mo M, Lin J, Ji X, Chen D, Liu Y. - Publikation: Front Neurol. 2021 Sep 14;12:715317 - DOI: 10.3389/fneur.2021.715317
- Repetitive task training for improving functional ability after stroke - Autoren: French B; Thomas LH; Coupe J; McMahon NE; Connell L; Harrison J; Sutton CJ; Tishkovskaya S; Watkins CL - Publikation: Cochrane Database Syst Rev. 2016;11:CD006073 - 10.1002/14651858.CD006073.pub3
- Management of Central Poststroke Pain: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. - Autoren: Mulla S.M.; Wang L.; Khokhar R.; Izhar Z.; Agarwal A.; Couban R.; Buckley D.N.; Moulin D.E.; Panju A.; Makosso-Kallyth S.; Turan A.; Montori V.M.; Sessler D.I.; Thabane L.; Guyatt G.H.; Busse J.W. - Publikation: Stroke 2015;46(10):2853–2860. - DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.010259
- Central Post-Stroke Pain Syndrome. [Updated 2024 Jun 7]. - Autoren: Anosike KC, Rajaram Manoharan SVR. - Publikation: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. - URL: Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK604196 (08.09.2025)
- Central post-stroke pain: clinical characteristics, pathophysiology, and management. - Autoren: Klit H, Finnerup NB, Jensen TS. - Publikation: Lancet Neurol. 2009 Sep;8(9):857-68. - DOI: 10.1016/S1474-4422(09)70176-0


