Angiographie ▷ Anwendung, Methoden und Patienteninformationen

Die Angiographie hat ein breites Anwendungsspektrum (Foto: Mehmet Cetin | Shutterstock)
In diesem Artikel:
- Das Wichtigste in Kürze
- Was ist eine Angiographie?
- Wann wird eine Angiographie veranlasst?
- Wann ist eine Angiographie nicht als Untersuchungsmethode geeignet?
- Ablauf der Angiographie und Tipps zur Vorbereitung
- Fragen und Antworten zur Angiographie
- Überblick über verschiedene Angiographie-Verfahren
- Geschichte der Angiographie
Das Wichtigste in Kürze:
Für alle, die gleich in die Tiefe gehen und mehr wissen möchten: Hier geht es zur ausführlichen Version des Artikels.Die Angiographie ist die wichtigste und aussagekräftigste Untersuchungsmethode zur Darstellung und Beurteilung von arteriellen und venösen Blutgefäßen.
Durch die Angiographie lassen sich vor allem Engstellen (Stenosen) und Verschlüsse von Blutgefäßen feststellen.
Eine Angiographie eignet sich zur (unterstützenden) Diagnostik bei folgenden Erkrankungen:
- Arteriosklerotische Erkrankungen der Gefäße
- Gefäßfehlbildungen
- Ischämischer Schlaganfall
- Hirnblutung
- Herzinfarkt
- Verengung der Herzkranzgefäße
- Hirntumore
- Angiopathie
- Therapieplanung bei Krampfadern, sogenannten Varizen und
Kreislaufstörungen - Raynaud-Syndrom
- Veneninsuffizienz
- Anomalien des Herzens
In diesen Fällen ist der Einsatz einer Angiographie nicht geboten:
- Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem jodhaltigen Kontrastmittel
- angeborene oder erworbene Gerinnungsstörung mit erhöhter Blutungsneigung
- schwere Funktionseinschränkung der Nieren (Niereninsuffizienz)
- eine dekompensierte Herzinsuffizienz mit verminderter Pumpleistung des Herzens2
Neben der herkömmlichen Angiographie durch Einspritzung eines Röntgenkontrastmittels direkt in eine Arterie gibt es weniger eingreifende Methoden . Dazu gehören die Computertomographie-Angiographie (CTA) oder die Magnetresonanztomographie-Angiographie (MRA).
Die radiologische Darstellung der Blutgefäße im Halsbereich und Gehirn wird als zerebrale Angiographie bezeichnet.
Die Kontrastmitteluntersuchung von Venen wird als Phlebographie bezeichnet, die der Lymphgefäße als Lymphographie.
3 Tipps an Patienten für den reibungslosen Ablauf und das Aufklärungsgespräch:
- Notieren Sie alle Ihre Fragen zur Untersuchung.
- Bringen Sie wichtige Arztbriefe oder Laborberichte mit.
- Sprechen Sie mögliche Ängste an.
Im Aufklärungsgespräch informiert der Arzt oder die Ärztin über Nutzen und Ablauf der Angiographie, aber auch über die damit verbundenen Risiken. Die Einnahme bestimmter Medikamente vor der Untersuchung, wie „Blutverdünner“ beziehungsweise Gerinnungshemmer, sollte dringend ärztlich abgeklärt werden.
Durch gerinnungshemmende Medikamente kann es unter Umständen zu unerwünschten, stärkeren Blutungen kommen.
Welche Informationen sind vor der Angiographie wichtig?
- aktuelle Gerinnungswerte
- Nierenwerte
- Schilddrüsenwerte
- bekannte Kontrastmittel-Überempfindlichkeiten
- Einnahme gerinnungshemmender Medikamente
Wie lange die angiographische Untersuchung dauert, richtet sich nach der eingesetzten Angiographie-Methode und der Gefäßregion, die untersucht werden soll.
Grundsätzlich ist die Angiographie eine sehr sichere und meist schmerzfreie Untersuchungsmethode. Seltene Komplikationen treten auf, wenn …
- Patienten allergisch gegen das Kontrastmittel reagieren,
- es zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion oder eine Schilddrüsenüberfunktion kommt,
- Blutungen und Verletzungen von Gefäßen oder Gewebe entstehen,
- Nervenschädigungen und Infektionen auftreten,
- die Strahlenbelastung hoch ist.
Die untersuchte Stelle wird entweder örtlich betäubt oder die untersuchte Person unter Narkose gesetzt. Körperlich können ein leichtes Druckgefühl oder Brennen, ein vorübergehendes Wärmegefühl oder leichte Schmerzen an der Einstichstelle zu spüren sein.
Nach der Untersuchung wird das Befinden der untersuchten Person beobachtet und der Befund gemeinsam besprochen.
Auf die Angiographie folgt eine Ruhephase, körperliche Schonung, Eigenbeobachtung der
Einstichtstelle durch die Patienten, ausreichendes Trinken, Wundpflege und Kontrolltermine.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Was ist eine Angiographie?
Die Angiographie ist ein Verfahren zur Darstellung von Blutgefäßen.
Für die klassische Röntgen-Angiographie werden meist jodhaltige Kontrastmittel über einen dünnen, flexiblen Schlauch oder eine Kanüle in das zu untersuchende Gefäß verabreicht. Der Schlauch wird als Katheter bezeichnet.
Durch die Anfertigung einer Serie von Röntgenbildern wird die Verteilung des Kontrastmittels verfolgt. Darüber ist eine Gefäßdarstellung möglich. Die entstandenen Bilder werden als Angiogramm bezeichnet.
Mithilfe der Angiographie können unter anderem als Stenosen bezeichnete Verengungen erkannt werden. Auch Verschlüsse von Blutgefäßen werden sichtbar.
Darüber hinaus ist die Beurteilung tumorversorgender Gefäße möglich. Liegt eine Verengung vor, kann unter bestimmten Bedingungen direkt im Anschluss an die Angiographie das Gefäß mit einem Ballon offen gehalten werden. Zudem können Stents gesetzt werden, die das Gefäß stützen.
Die radiologische Darstellung der Blutgefäße im Halsbereich und Gehirn wird als zerebrale Angiographie bezeichnet.
Wann wird eine Angiographie veranlasst?
Die Angiographie wird zur Untersuchung verschiedener Krankheiten eingesetzt, die das Gefäßsystem betreffen.
Eine Angiographie kann unter anderem zur (unterstützenden) Diagnostik bei folgenden Erkrankungen durchgeführt werden:
- Arteriosklerotische Erkrankungen der Gefäße von hirnversorgenden Arterien im Halsbereich, den Armen und Beinen, wie die Karotisstenose, die Stenose der Bauchaorta oder die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz pAVK
- angeborene oder erworbene Gefäßfehlbildungen
- Ischämischer Schlaganfall
- Hirnblutung
- Herzinfarkt
- Verengung der als Koronararterien bezeichneten Herzkranzgefäße im Rahmen der koronaren Herzkrankheit, kurz KHK
- Hirntumore
- als Angiopathie bezeichnete Gefäßschädigungen, zum Beispiel als Folge der Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus
- Phlebographie zur Therapieplanung bei Krampfadern, sogenannten Varizen und
Kreislaufstörungen wie dem sogenannten Vena cava Syndrom, das vorwiegend bei Schwangeren auftritt und bei dem durch Druck auf die Hohlvene das Blut nicht mehr ungehindert zum Herzen fließen kann - attackenartige Durchblutungsstörungen der Finger beim sogenannten Raynaud-Syndrom
- Veneninsuffizienz: durch Fehlfunktionen der Venenwände oder Venenklappen geschwächte Gefäße, die sauerstoffarmes Blut aus dem Körper zurück zum Herzen leiten
- bei angeborenen oder erworbenen Anomalien des Herzens, der Herzklappen oder Herzkranzgefäße
In seltenen Fällen wird die Angiographie auch zur Feststellung des Hirntodes eingesetzt.2
Sollen Gefäßabschnitte nur zu diagnostischen Zwecken untersucht werden, eignet sich in den meisten Fällen eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT).
Heutzutage bietet die Angiographie weit mehr als nur diagnostischen Nutzen. Sie kann darüber hinaus auch therapeutisch eingesetzt werden.
Therapeutisch findet die Angiographie unter anderem Anwendung bei:
- der sogenannten perkutanen transluminalen Angioplastie zur Erweiterung von verengten Blutgefäßen mithilfe eines als Ballonkatheter bezeichneten dünnen, flexiblen Schlauches, an dessen Spitze sich ein aufblasbarer Ballon befindet
- dem Setzen von als Stent bezeichneten Gefäßstützen aus Metall oder Kunstfasern
- der als Thrombolyse bezeichneten medikamentösen Beseitigung von Blutgerinnseln
- als Chemoembolisation bezeichnete lokale Chemotherapie, vor allem im Rahmen von primären Leberzellkarzinomen und Lebermetastasen, bei der das Zytostatikum gezielt am Ort des Tumors appliziert wird.2
Anwendungsgebiete der Angiographie des Großhirns
Eine Angiographie des Großhirns wird unter anderem zu folgenden Zwecken durchgeführt:
- Beurteilung der hirnversorgenden Arterien im Halsbereich und im Gehirn nach einem Schlaganfall
- Untersuchungen und Kontrolle vor und nach operativen Eingriffen bei Hirngefäßanomalien, zum Beispiel bei als Aneurysmen bezeichneten Ausbuchtungen der Gefäßwände oder Einrissen im Gefäß (Dissektion)
- Einschätzung, ob ein tumorversorgendes Gefäß vor der operativen Entfernung des Tumors verschlossen werden soll. Das kann die Ausgangssituation vor der Operation hinsichtlich der Größe eines Tumors verbessern.
- für gezielte Eingriffe, zum Beispiel die Thrombektomie.3
Kontraindikation: Wann ist eine Angiographie nicht als Untersuchungsmethode geeignet?
Neben zahlreichen Gründen, die für den Einsatz der Angiographie als Untersuchungsmethode sprechen, gibt es auch Fälle, in denen sie kontraindiziert ist, also bestimmte Faktoren gegen den Einsatz sprechen.
Zu den Kontraindikationen zählen unter anderem:
- Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem für die Angiographie benötigten jodhaltigen Kontrastmittel
- eine angeborene oder erworbene Gerinnungsstörung mit erhöhter Blutungsneigung, die sogenannte hämorrhagische Diathese
- eine schwere Niereninsuffizienz, eine Funktionseinschränkung der Nieren, bei der bestimmte Substanzen nicht mehr im notwendigen Maß ausgeschieden werden können und sich folglich im Blut ansammeln
- eine dekompensierte Herzinsuffizienz mit verminderter Pumpleistung des Herzens2
Allgemeiner Ablauf der Angiographie
Bereiten Sie sich bestmöglich auf die Angiographie vor
Mit der richtigen Vorbereitung können Sie dazu beitragen, dass die Untersuchung sicher und komplikationsfrei verläuft.
Haben Sie bestimmte Fragen? Notieren Sie sich diese für das anstehende Aufklärungsgespräch.
Vielleicht möchten Sie wissen, ob und wie lange Sie für die Untersuchung nüchtern bleiben müssen? Oder wie lange Sie nach dem Eingriff nicht arbeiten können? Ihre Fragen können auch Risiken im Vorfeld klären und helfen, Ihnen die Angst vor der Untersuchung zu nehmen.
Liegen Ihnen Arztbriefe oder Laborberichte vor, die für die Untersuchung wichtig sein könnten? Bringen Sie sie zum Aufklärungsgespräch mit.
Je mehr Informationen dem Arzt oder der Ärztin vor der Angiographie zur Verfügung stehen, desto besser. Besonders wichtig sind aktuelle Laborbefunde mit Schilddrüsen-, Nieren- und Gerinnungswerten sowie Informationen zur Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten oder bekannten Kontrastmittel-Unverträglichkeiten.
Haben Sie Angst vor der Untersuchung? Sprechen Sie darüber mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Angst vor einer Untersuchung zu haben, ist völlig normal und in Ordnung. Viele Ängste sind unbegründet und lösen sich nach einem gut vorbereiteten Arztgespräch auf.
Das Aufklärungsgespräch
Unabhängig von der Methode, mit der das Angiogramm erstellt wird, findet einige Zeit vor der Angiographie ein Aufklärungsgespräch zwischen der die Untersuchung leitenden und der untersuchten Person statt.
Jeder ärztliche Eingriff stellt aus rechtlicher Sicht eine Körperverletzung dar. Daher erfordert das ärztliche Handeln neben der Beachtung fachlicher Regeln, dem Einhalten der Sorgfaltspflicht bei der Durchführung und der medizinischen Notwendigkeit für den Eingriff auch die mündliche Aufklärung und anschließende Einwilligung der Patienten.4
Ziel des Gespräches ist die Vorbereitung auf die Untersuchung, aber auch die Aufklärung über ihren Nutzen und Ablauf und die damit verbundenen Risiken. In der Regel wird das Gespräch schriftlich dokumentiert. Meist geschieht das auf einem eigens für die jeweilige Untersuchung vorgesehenen Standard-Aufklärungsbogen. Die Patienten bestätigen durch ihre Unterschrift ihre Einwilligung.
Die Durchführung der Untersuchung
Bevor eine Beurteilung von Gefäßen durch die Angiographie möglich wird, muss festgelegt werden, wie der Zugang zum Gefäß erfolgen soll. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:1,5
Der direkte Zugang
Bei der sogenannten direkten Punktion wird das Kontrastmittel direkt durch eine Nadel in ein arterielles Blutgefäß gespritzt. Dafür wird eine geeignete Stelle gesucht. Diese hängt von der Lage des Gefäßes im Körper ab.
Der Zugang erfolgt mit speziellen feinen Nadeln unter örtlicher Betäubung. Die Punktionsnadel hat einen Durchmesser von weniger als einem Millimeter. Deswegen wird die Untersuchung auch als Feinnadel-Angiographie bezeichnet.
Die Methode wird bevorzugt, wenn nur ein ganz bestimmter Bereich untersucht werden soll. Während der Untersuchung verbleibt die Nadel im Gefäß.
Einführung eines Katheters durch die Haut
Diese Methode wird auch als perkutane Katheter-Injektion bezeichnet. Das Einführen des Katheters wird üblicherweise nach der Seldinger-Technik durchgeführt.
Zunächst wird nach der örtlichen Betäubung mit einer speziellen Punktionsnadel in das Gefäß gestochen. Durch den Katheter ist es möglich, ganz gezielt bestimmte Gefäßabschnitte zu erreichen.
Die Katheter-Technik wird vor allem zur Untersuchung großer Gefäße verwendet. Auch weiter entfernte Gefäßabschnitte können hiermit zuverlässig untersucht werden. Der Katheter dient als Verlängerungsschlauch, um genau dort Kontrastmittel hinzubringen, wo es benötigt wird.
Nach der direkten Punktion endet der Eingriff nach der Untersuchung des gewünschten Gefäßes. Die Nadel wird aus dem Gefäß entfernt und die Einstichstelle versorgt.
Mit der Katheter-Technik kann nach der angiographischen Untersuchung bei Bedarf ein weiterer Eingriff erfolgen.
Ein eingeengtes Gefäß kann beispielsweise mit einem Ballon geöffnet werden. Dieses Verfahren wird als Perkutane transluminale Angioplastie bezeichnet.
Auch eine als Stent bezeichnete Gefäßstütze kann die gewünschte Stelle offen halten. Dieses Verfahren wird vorzugsweise an den Herzkranzarterien, den hirnversorgenden Arterien im Halsbereich, der Bauchaorta und den Arterien im Becken- und Beinbereich verwendet.
Kontrastmitteleinsatz bei der Angiographie
Um die Gefäße deutlich sichtbar machen zu können, ist der Einsatz von Kontrastmitteln erforderlich.
Damit heben sich die Gefäße vom umliegenden Gewebe ab. Die heute eingesetzten Kontrastmittel sind meist wasserlöslich und besitzen keine elektrische Ladung. Sie enthalten Jod und werden in das zu untersuchende Gefäß gespritzt.
Zwei in der heutigen Praxis häufig verwendete Substanzen sind das unter dem Handelsnamen Visipaque bekannte Kontrastmittel der Firma GE Healthcare Buchler sowie ein Kontrastmittel der Firma Bayer Schering Pharma mit dem Handelsnamen Ultravist.1
Diese Kontrastmittel sind so beschaffen, dass sie Röntgenstrahlung stärker aufnehmen als das umliegende Gewebe. Auf dem Röntgenbild erscheinen sie dadurch heller und mit ihnen das Gefäß, in dem sie zirkulieren. Man bezeichnet sie als positive Kontrastmittel.
Da jodhaltige Kontrastmittel für einige Patientinnen und Patienten nicht geeignet sind, muss die Untersuchung in diesen Fällen mit anderen Kontrastmitteln durchgeführt werden. Dazu kann beispielsweise auf folgende Alternativen zurückgegriffen werden:5
- Positives Kontrastmittel: Gadolinium-DTPA
- Negatives Kontrastmittel: Kohlenstoffdioxid, CO2
Nachbeobachtung und Befundbesprechung
Nach Abschluss der Untersuchung hängt das weitere Vorgehen davon ab, ob für die Untersuchung ein Kontrastmittel verabreicht und ob die Angiographie unter örtlicher Betäubung oder allgemeiner Narkose durchgeführt wurde.
Bei einer allgemeinen Narkose wird die untersuchte Person üblicherweise für eine gewisse Zeit in einem Aufwachraum untergebracht. Dabei wird beobachtet, ob Komplikationen auftreten. Das können Blutungen oder eine allergische Überempfindlichkeitsreaktion auf das Kontrastmittel sein.
Ist der Zugang über die Leiste erfolgt, ist meist eine mehrstündige ruhige Lagerung notwendig. Es soll dadurch sichergestellt werden, dass sich die Einstichstelle verschließen kann und keine Nachblutungen durch Bewegung entstehen.
In seltenen Fällen ist es notwendig, Patienten über Nacht im Krankenhaus zu behalten. Das kann vorkommen, wenn eine zeitkritische Operation durchgeführt werden muss oder Komplikationen aufgetreten sind.
Die Befundbesprechung erfolgt in der Regel unmittelbar nach der Untersuchung und Nachbeobachtung.
In einigen Fällen wird ein gesonderter Termin zur Besprechung vereinbart. So kann der Arzt oder die Ärztin in Ruhe das weitere Vorgehen und mögliche Behandlungsstrategien planen.
Fragen und Antworten zur Angiographie
Muss man nüchtern zur Angiographie erscheinen?
Ob man nüchtern zur Angiographie kommen muss, lässt sich nicht pauschal beantworten. Das hängt von der Art der Untersuchung ab.
Verschiedene Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Dazu zählt unter anderem, ob die Untersuchung unter Narkose durchgeführt wird und ob Kontrastmittel benötigt werden.
Für einfache Untersuchungen ohne Narkose und Kontrastmittel muss die untersuchte Person in der Regel nicht nüchtern sein.6
In den häufigsten Fällen werden Patienten gebeten, zur Untersuchung nüchtern zu erscheinen, falls eine Narkose erforderlich ist. Zudem wird das Risiko dafür gesenkt, dass aufgrund des Kontrastmittels Übelkeit oder sogar Erbrechen auftreten.
Eine Dauer von etwa 4 bis 6 Stunden ohne Essen und Trinken vor der Untersuchung hat sich in vielen Fällen bewährt.7,8,9 Einige Arztpraxen und Kliniken empfehlen bis zu 12 Stunden.10
Einnahme bestimmter Medikamente vor der Untersuchung abklären
Die Einnahme bestimmter Medikamente vor der Untersuchung, wie „Blutverdünner” beziehungsweise Gerinnungshemmer sollte dringend ärztlich abgeklärt werden.
Durch gerinnungshemmende Medikamente kann es unter Umständen zu unerwünschten, stärkeren Blutungen kommen.
Welche Informationen braucht der Arzt vor der Angiographie?
Vor einer anstehenden Angiographie haben viele Menschen Fragen, denen sie im Aufklärungsgespräch vor der Untersuchung gerne Raum geben dürfen.
Aber auch die Ärztin oder der Arzt benötigt einige Informationen, um die Untersuchung sicher und mit möglichst geringem Risiko für den Patienten oder die Patientin durchführen zu können.
Welche Informationen sind vor der Angiographie wichtig?
- aktuelle Gerinnungswerte: Um das Risiko für unerwartete Blutungen zu minimieren, ist es wichtig, dass vor der Untersuchung möglichst aktuelle Gerinnungswerte vorliegen. Diese können entweder von einer hausärztlichen Routine-Laboruntersuchung stammen oder eigens für die Angiographie bestimmt werden.
- Nierenwerte: Häufig werden bei der Angiographie Kontrastmittel eingesetzt. Damit diese wieder aus dem Körper ausgeschieden werden können, müssen die Nieren einwandfrei arbeiten. Eine beeinträchtigte Nierenfunktion durch Vorerkrankungen muss vorher bekannt sein, um Komplikationen zu vermeiden und sich im Bedarfsfall gegen die Untersuchung zu entscheiden.
- Schilddrüsenwerte: Einige für die Untersuchung häufig eingesetzte Kontrastmittel sind auf Jodbasis. Liegt eine Schilddrüsenüberfunktion, also eine Hyperthyreose vor, kann das jodhaltige Kontrastmittel zur Verschlechterung der Erkrankung führen. In diesem Fall wird für die Untersuchung üblicherweise auf andere Kontrastmittel ausgewichen.
- bekannte Kontrastmittel-Überempfindlichkeiten: Sind in der Vergangenheit bereits Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber einem Kontrastmittel aufgetreten, wird auch hier nach Alternativen gesucht.
- Einnahme gerinnungshemmender Medikamente: Die Einnahme von Gerinnungshemmern kann in bestimmten Fällen das Risiko für Blutungen erhöhen. Patienten werden daher gegebenenfalls in Abhängigkeit von der geplanten Untersuchungsmethode darum gebeten, für die Untersuchung auf die Einnahme der Medikamente zu verzichten.
Wie lange dauert die Angiographie?
Wie lange die angiographische Untersuchung dauert, richtet sich nach ...
- der eingesetzten Angiographie-Methode und
- der Gefäßregion, die untersucht werden soll.
Eine CT-Angiographie ist im Durchschnitt nach etwa 30 Minuten abgeschlossen. Eine Magnetresonanz-Angiographie ist mit bis zu 45 Minuten aufwendiger. Bei einfachen Fragestellungen kann sie aber auch bereits nach 20 Minuten abgeschlossen sein.
Am längsten dauert eine digitale Subtraktions-Angiographie mit durchschnittlich 1-2 Stunden.11
Je nach individueller Situation kann die Untersuchungsdauer von den durchschnittlichen Angaben abweichen.
Welche Nebenwirkungen und Komplikationen können bei der Angiographie auftreten?
Grundsätzlich ist die Angiographie eine sehr sichere und meist schmerzfreie Untersuchungsmethode.
Komplikationen sind selten. Meist treten sie auf, wenn die Angiographie durchgeführt wird, obwohl sie für die untersuchte Person nicht geeignet ist.
Komplikationen können unter anderem durch das verabreichte Kontrastmittel auftreten. Etwa 3 Prozent der Patienten reagieren darauf allergisch.2,5
In seltenen Fällen kann das Kontrastmittel eine akut lebensbedrohliche Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems hervorrufen.
Auch eine Verschlechterung der Nierenfunktion oder eine Schilddrüsenüberfunktion können durch das verwendete Kontrastmittel ausgelöst werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist sehr gering.
Ärztinnen und Ärzte, die eine Angiographie durchführen, sind dennoch gut auf solche Situationen vorbereitet. Im Notfall sind sie schnell handlungsfähig.
Des Weiteren kann es zu Blutungen und Verletzungen von Gefäßen oder Gewebe kommen.
Auch der Verschluss eines Blutgefäßes durch Verschleppung eines Blutgerinnsels aus einem anderen Gefäß, eine sogenannte Thromboembolie, ist möglich.
Nervenschädigungen und Infektionen des Zugangsweges bis hin zur Blutvergiftung sind ebenfalls möglich. Sie treten jedoch sehr selten auf.
Bei Angiographiemethoden, bei denen es zum Einsatz von Röntgenstrahlen kommt, muss mit einer Strahlenbelastung gerechnet werden. Die Strahlendosis ist in der Regel vergleichsweise gering.
Das Risiko durch die Strahlenbelastung wird gründlich gegen den Nutzen der Untersuchung abgewägt. Darüber hinaus verfügen die Arztpraxen und Kliniken über verschiedene Möglichkeiten, um die Strahlenbelastung gering zu halten und empfindliche Organe zu schützen.
Verursacht eine Angiographie Schmerzen?
Üblicherweise ist die Angiographie mit keinen oder geringfügigen Schmerzen verbunden.
In der Regel wird die Untersuchung unter örtlicher Betäubung oder Narkose durchgeführt. In einigen Fällen können kurz unangenehme Empfindungen auftreten, die jedoch nicht schmerzhaft sind.
Dazu zählen ein leichtes Druckgefühl oder Brennen beim Einführen der Nadel/des Katheters oder ein vorübergehendes Wärmegefühl bei der Verabreichung des Kontrastmittels.
Mögliche leichte Schmerzen können nach der Untersuchung an der Einstichstelle auftreten. Diese klingen aber innerhalb weniger Tage wieder ab. mit keinen oder geringfügigen Schmerzen verbunden.
In der Regel wird die Untersuchung unter örtlicher Betäubung oder Narkose durchgeführt. In einigen Fällen können kurz unangenehme Empfindungen auftreten, die jedoch nicht schmerzhaft sind.
Dazu zählen ein leichtes Druckgefühl oder Brennen beim Einführen der Nadel/des Katheters oder ein vorübergehendes Wärmegefühl bei der Verabreichung des Kontrastmittels.
Mögliche leichte Schmerzen können nach der Untersuchung an der Einstichstelle auftreten. Diese klingen aber innerhalb weniger Tage wieder ab.
Gibt es Alternativen zur klassischen Angiographie?
Ja. Je nach Fragestellung oder gesundheitlicher Situation der Patienten können beispielsweise folgende Untersuchungsmethoden alternativ zur klassischen Röntgen-Angiographie eingesetzt werden:
- Computertomographie-Angiographie
- Magnetresonanz-Angiographie
- Fluoreszenz-Angiographie
- Ultraschall-Untersuchung mithilfe eines Doppler-Ultraschalls
Sollte aus gesundheitlichen Gründen keine dieser Untersuchungen in Frage kommen, kann eine Blutuntersuchung bis zu einem gewissen Grad Aufschluss über bestimmte Erkrankungen der Blutgefäße geben. Die Informationen sind allerdings nicht gleichwertig mit denen einer Angiographie.
In einigen Fällen ist die klassische Röntgen-Angiographie zudem unverzichtbar, vor allem, wenn mit der Untersuchung eine Behandlung wie das Setzen von Stents verknüpft ist.
Was umfasst die Nachsorge nach der Angiographie?
Nach der Angiographie gibt es einiges zu beachten:
- Ruhephase: Nach der Untersuchung sollten Patienten sich für einige Stunden schonen und eine Ruhephase einhalten. Die Dauer richtet sich nach der Art des Eingriffs. Wurde die Punktionsnadel in der Armbeuge eingeführt, ist in der Regel eine kürzere Ruhezeit notwendig als bei einem Einstich in der Leistengegend.
- Körperliche Schonung: Zug und Druck auf die Einstichstelle sollten vermieden werden. Deswegen sollten Patientinnen und Patienten für bis zu 48 Stunden nach der Untersuchung keinen Sport machen. Auch körperliche Anstrengungen durch Heben schwerer Gegenstände sollten auf spätere Zeitpunkte verschoben werden.
- Nachbeobachtung: Patientinnen und Patienten können für einige Zeit die Einstichstelle beobachten. Treten ungewöhnliche Schwellungen, Schmerzen, Rötungen, Blutungen, Verfärbungen oder ein Wärmeempfinden um die Einstichstelle auf, sollten diese ärztlich abgeklärt werden.
- Trinkverhalten: Zur schnellen Ausschwemmung des Kontrastmittels aus dem Körper kann ausreichendes Trinken hilfreich sein.
- Wundpflege: Die Einstichstelle sollte trocken und sauber gehalten werden. Bei Bedarf kann der Wundverband/das Pflaster regelmäßig gewechselt werden, bis alles verheilt ist.
- Kontrolltermin: Bei komplexen Untersuchungen oder Angiographie-Untersuchungen, bei denen im Anschluss eine Behandlung erfolgt ist wie beim Setzen von Stents, kann ein Kontrolltermin nötig sein, um den Behandlungserfolg zu überprüfen.
- Anpassung des Lebensstils: Einige Gefäßerkrankungen, die die Untersuchung/Behandlung im Rahmen der Angiographie erforderlich machen, können positiv durch einen gesunden Lebensstil beeinflusst werden. Daher sollte besonders bei solchen Erkrankungen nach der Angiographie eine Anpassung des Lebensstils in Betracht gezogen werden. Dazu gehört eine gesunde Ernährung ebenso wie ausreichende Bewegung und der Verzicht auf Nikotin und Alkohol.
Angiographie-Verfahren
Die Angiographie-Verfahren können entweder nach der Art des zu untersuchenden Gefäßes oder nach der verwendeten Methode eingeteilt werden, mit der die Bilder erzeugt werden.
Die Methode, die den derzeitigen Goldstandard zur Untersuchung von Gefäßen darstellt, ist die sogenannte digitale Subtraktionsangiographie, kurz DSA.
Einteilung nach zu untersuchendem Gefäß
Mittels Angiographie können drei Gefäßsysteme untersucht werden:
- dickwandige Arterien des Hochdrucksystems, die vom Herzen wegführen
- zum Herzen hinführende Venen des Niederdrucksystems mit dünnen Gefäßwänden
- in vier Gefäßtypen gliederbare Lymphgefäße: initiale Lymphgefäße, Präkollektoren, Kollektoren und Lymphsammelstämme
Die Angiographie der Arterien wird auch als Arteriographie, die der Venen als Phlebographie und die der Lymphe als Lymphographie bezeichnet.
Arten der Arteriographie
Carotis-Angiographie
Mit der Carotis-Angiographie werden Gefäße im Kopf und Hals im Bereich der Halsschlagader (Carotis) untersucht. Auch die Hirngefäße können dargestellt werden. Der Zugang erfolgt über die Leistenschlagader.
Je nach Fragestellung dauert die Untersuchung etwa eine Stunde. Bei einer ambulanten Durchführung kann der Patient oder die Patientin nach etwa 6 Stunden Ruhe- und Nachbeobachtungszeit nach Hause entlassen werden.12
Koronar-Angiographie
Die Koronar-Angiographie wird durchgeführt, wenn ein Verdacht auf verengte oder verstopfte Herzkranzgefäße besteht. Man spricht dann von der koronaren Herzkrankheit, kurz KHK.
Der Katheter kann entweder über eine große Arterie in der Leistengegend oder im Bereich des Handgelenks eingeführt werden (Linksherz- oder großer Herzkatheter) oder über eine Vene (Rechtsherz- oder kleiner Herzkatheter).
Über den Herzkatheter kann zunächst Kontrastmittel an die entsprechende Stelle gebracht werden. Nach der Bildgebung kann im Bedarfsfall das betroffene Gefäß mit einem Ballon offen gehalten oder durch Stents gestützt werden.13
Aortographie
In einigen Fällen ist eine Untersuchung der größten Schlagader im menschlichen Körper, der Aorta, erforderlich. Beispiele hierfür sind die Untersuchung einer Aortenklappenstenose, dem häufigsten Herzklappenfehler oder der Bauchaorta bei Verdacht auf eine Dissektion.
Die Aortenklappe ist eine Art Ventil, das die linke Herzkammer von der Hauptschlagader trennt.
Bei einer Aortenklappenstenose ist das Ventil verengt und es gelangt nicht mehr ausreichend Blut vom Herzen in die Hauptschlagader. Die verabreichte Kontrastmittelmenge richtet sich nach dem Durchmesser des zu untersuchenden Gefäßabschnittes.14
Arten der Phlebographie
Varikographie
Mit der Varikographie werden unter Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln oberflächliche und tiefer liegende Venen, vor allem der Beine oder Arme untersucht. Das kann überwiegend bei einer Beinvenenthrombose oder zur Beurteilung der Venenklappenfunktion bei einem Krampfaderleiden erforderlich sein.
Zur alleinigen bildgebenden Untersuchung wird heute meist die Magnetresonanztomographie bevorzugt. Folgt auf die Untersuchung jedoch die Verödung von Gefäßfehlbildungen, wird die röntgenbasierte Varikographie als das Verfahren der Wahl angesehen.
Der Einsatz von Röntgenstrahlen ist mit einigen Risiken verbunden. Daher muss vor der Untersuchung das Risiko-Nutzen-Verhältnis gründlich geprüft werden. Darüber hinaus müssen alle Möglichkeiten zur Senkung der Strahlenbelastung eingesetzt werden.15
Einteilung nach Bildgebungsverfahren
Die Angiographie-Untersuchung kann sich auch darin unterscheiden, mit welchem Verfahren die Bilder von den Gefäßen erzeugt werden.
Magnetresonanz-Angiographie (MRA)
Die Magnetresonanz-Angiographie, kurz MRA, eignet sich besonders gut zur dreidimensionalen Darstellung der Gefäße.5 Die Gefäße können isoliert von ihrer Umgebung dargestellt werden, weil umliegendes Gewebe bei den Aufnahmen herausgefiltert werden kann.
Durch eine spezielle Technik namens Time-of-Flight-MRA (TOF-MRA) werden schnelle Einzelimpulse erzeugt. Dadurch geben feste umliegende Gewebestrukturen nur ein sehr schwaches Signal ab. Fließendes Blut hingegen erzeugt ein sehr starkes Signal.
Die Folge ist die besonders kontrastreiche Darstellung der Blutgefäße vor einem kontrastarmen Hintergrund.
Die TOF-MRA eignet sich vor allem zur Darstellung der Gefäße innerhalb des Schädels, insbesondere der hirnversorgenden Gefäße.
Auch kontrastmittel-verstärkte Angiographien (CE-MRA) sind möglich. Dadurch können die Messzeiten extrem verkürzt werden. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn man Aufnahmen erzeugen möchte, während die untersuchte Person den Atem anhält. Dadurch werden Bewegungs-Störungen vermieden.
Durch die MRA werden im Allgemeinen einzelne Schichtbilder aufgenommen, die zu einem dreidimensionalen Bild zusammengesetzt werden können. Gegenüber anderen Angiographie-Verfahren hat sie den entscheidenden Vorteil, dass weder ionisierende Strahlung noch jodhaltige Kontrastmittel eingesetzt werden.
CT-Angiographie (CTA)
Bei der CT-Angiographie wird ein jodhaltiges Kontrastmittel in eine Vene verabreicht. Anschließend erfolgt die Bilderzeugung und -weiterverarbeitung mittels Computertomographie, kurz CT. Die CTA ist besonders vorteilhaft bei der Beurteilung von Gefäßverengungen und -verschlüssen.5
Durch ein Spiral-CT können die Daten nach der Kontrastmittelverabreichung genau dann erfasst werden, wenn das Kontrastmittel sich hauptsächlich in den Arterien befindet. Diesen Zeitraum kurz nach der Verabreichung des Kontrastmittels nennt man arterielle Bolus-Phase.
Bei CT-Scannern, die über mehrere Detektoren-Zeilen zur Erfassung der Röntgenstrahlung verfügen, können auch große Gefäßabschnitte sehr gut dargestellt werden.
Die aufgenommenen Schichtbilder können im Anschluss an das CT am Computer weiter bearbeitet werden. Die CTA hat im Vergleich zur MRA eine bessere räumliche Auflösung. Auch Störungen durch Atembewegungen haben hier geringere Auswirkungen, weswegen sie gerne zur Beurteilung von Gefäßen im Bereich der Lunge und des Oberbauchs eingesetzt wird.
Digitale Subtraktionsangiographie (DSA)
Die Technik der digitalen Subtraktionsangiographie, kurz DSA, gibt es bereits seit vier Jahrzehnten. Sie zeichnet sich im Vergleich mit der klassischen Röntgen-Angiographie dadurch aus, dass weniger Kontrastmittel benötigt wird.
Das Verfahren ist computergestützt. Dadurch lässt sich eine deutlich bessere Bildqualität erreichen als mit den klassischen Geräten. Vor allem bei Verabreichung des Kontrastmittels über einen Katheter sind sehr gute Aufnahmen möglich.16
Das Angiographie-Gerät besteht aus mehreren Einheiten:
- Röntgeneinheit zur Erzeugung der Röntgenstrahlung: Das System zur Signalerkennung und Bildverstärkung ist mit der Röntgenröhre über einen C-förmigen Bogen verbunden. Das ermöglicht Aufnahmen in allen Raumebenen.
- Strahlungsdurchlässiger Untersuchungstisch: Patienten werden für die Dauer der Untersuchung auf einem Tisch gelagert, der die Röntgenstrahlung ungehindert durchlässt.
- Computereinheit für die digitale Bildverarbeitung: Die Computereinheit ist mit Bildbearbeitungsprogrammen ausgestattet und erlaubt die weitere Bearbeitung der digitalen Durchleuchtungsbilder.5
Die DSA ermöglicht, dass alle Körperstrukturen aus den Bildern subtrahiert, also herausgefiltert werden. Übrig bleiben demnach nur Strukturen, die durch das zuvor verabreichte Kontrastmittel sichtbar gemacht werden.
Das hat den Vorteil, dass es nicht zu Bildüberlagerungen durch Strukturen kommt, die teilweise oder vollständig übereinanderliegen.
Um für die Untersuchung nicht interessante Körperstrukturen herausfiltern zu können, wird zuerst ein Maskenbild ohne Kontrastmittel erstellt.
Die gewonnenen Daten werden dann von dem Füllungsbild abgezogen, das nach Verabreichung des Kontrastmittels aufgenommen wurde.5 Übrig bleibt die Darstellung des zu untersuchenden Gefäßes.
Bei Bedarf können weitere nachträgliche Bearbeitungen der Bilder vorgenommen werden. So beispielsweise die Vergrößerung bestimmter Abschnitte. Es können auch zwei nacheinander aufgenommene Bilder übereinander gelegt werden.
Die DSA wird besonders in den medizinischen Teilgebieten Neuroradiologie und interventionelle Radiologie genutzt. Diese beschäftigen sich mit der bildgebenden Untersuchung und Therapie des Nervensystems und mit kleinen bildgesteuerten Eingriffen.
Die DSA wird heute standardmäßig für die Darstellung von Arterien eingesetzt.
Wird die DSA unter Rotation des C-Bogens aufgenommen, können die Gefäße sogar in mehreren Ebenen dargestellt werden.
Fluoreszenz-Angiographie
Die Fluoreszenz-Angiographie wird zur Untersuchung der Blutgefäße des Auges eingesetzt, die die Netzhaut und Aderhaut durchziehen. Hierfür wird das Natriumsalz eines speziellen Farbstoffes namens Fluorescein verwendet.
Eine Fluoreszenz-Angiographie kann notwendig sein, wenn Netzhaut- und Aderhaut-Erkrankungen untersucht und deren Verlauf beobachtet werden soll. Ein Beispiel hierfür ist die Schädigung der kleinen Blutgefäße in der Netzhaut durch dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel im Rahmen der Zuckerkrankheit Diabetes mellitus.2
Ultraschall-Angiographie durch farbkodierte Duplexsonographie (FKDS)
Die farbkodierte Duplexsonographie, kurz FKDS, ist eine spezielle Ultraschalltechnik zur Darstellung von Blutgefäßen. Es können Lage, Gestalt und Blutfluss untersucht werden.17
Für die Flussrichtung und die Flussgeschwindigkeit gibt es Farbcodes:
- Die Flussrichtung wird in Rot oder Blau dargestellt. Die Ärztin oder der Arzt kann festlegen, welche Richtung mit welchem Farbton gekennzeichnet wird. Üblicherweise bedeutet Rot = vom Schallkopf weg und Blau = zum Schallkopf hin.
- Eine Darstellung der Flussgeschwindigkeit erfolgt durch Abstufungen in der Helligkeit.
Besonders häufig wird die Farb-Dopplersonographie zur Beurteilung der hirnversorgenden Gefäße eingesetzt, die außerhalb des Schädels liegen.
Durch die kombinierte Untersuchung von Gefäßstruktur und Blutfluss kann ärztlich entschieden werden, ob ein verengtes oder verschlossenes Blutgefäß durch geeignete Behandlungsmethoden geöffnet werden muss.
Die Wiedereröffnung des Gefäßes bezeichnet man als Revaskularisierung.
Exkurs in die Vergangenheit: Geschichte der Angiographie
Das erste Angiogramm wurde bereits 1886 erzeugt, als Eduard Haschek und Otto T. Lindenthal eine Mischung aus Kreide, Zinnober und Steinöl in die Arterien einer amputierten Leichenhand füllten (Goldyn 2014). Das als Teichmann-Paste bezeichnete Gemisch konnte jedoch nicht für die Angiographie am lebenden Menschen eingesetzt werden.
Die Entwicklung geeigneter Kontrastmittel war eine Herausforderung. Daher konnte die erste Angiographie am lebenden Menschen erst Jahrzehnte später, im Jahr 1923, mit Natriumjodid als Kontrastmittel erfolgen.
Ende der 1920er Jahre folgten dann zwei weitere Kontrastmittel: Thorotrast und Uroselectan. Trotz ihrer radioaktiven und Fehlbildungen hervorrufenden Eigenschaften wurden diese über 30 Jahre lang als Kontrastmittel eingesetzt.
Im Jahr 1953 kam es zu einem weiteren Meilenstein der Angiographie, durch welchen die Durchführung des radiologischen Verfahrens ohne Anwesenheit eines Gefäßchirurgen möglich wurde: die Seldinger-Methode. Sie ist nach dem schwedischen Radiologen Sven-Ivar Seldinger benannt. Seldinger entwickelte eine perkutane Katheter-Einführungstechnik, die auch heute noch in der Praxis Anwendung findet.
Sie möchten eine schnelle Antwort? Dann fragen Sie unsere KI-Assistentin Lola.
- Überblick über Untersuchungsmethoden zur Diagnostik des Schlaganfalls und seiner Risikofaktoren
- Neuroradiologie
- Neurologische Untersuchungen
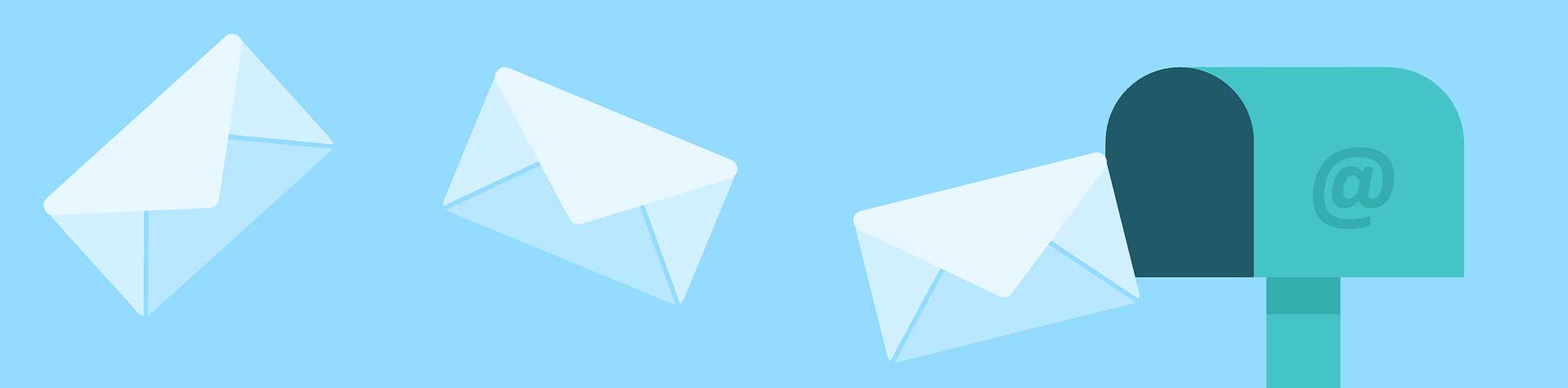
Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter! Wir schicken Ihnen regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund zum Schlaganfall: Grundlagen-Informationen, Ratgeber, konkret umsetzbare Tipps und aktuelle Studien.
Die Zeit nach der Klinik ist für Angehörige oft die größte Herausforderung. Unser Online-Kurs führt Sie in 13 kompakten Modulen durch die Zeit danach. Der Kurs ist ein kostenfreies Angebot gesetzlicher Krankenkassen nach § 45 SGB XI.
Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autoren
Dipl.-Biol. Claudia Helbig unter Mitarbeit von Prof. Dr. med. Hans Joachim von Büdingen
Claudia Helbig ist Diplom-Human- und Molekularbiologin und hat zuvor eine Ausbildung zur Arzthelferin absolviert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Medizinischen Biochemie und Molekularbiologie hat sie Medizinstudenten in Pathobiochemie-Seminaren und Praktika betreut. Nach Ihrer Arbeit in der pharmazeutischen Forschung hat sie in einem Auftragsforschungsinstitut für klinische Studien unter anderem Visiten mit Studienteilnehmern zur Erhebung von Studiendaten durchgeführt und Texte für die Website verfasst. Mit ihrem interdisziplinären Hintergrund und ihrer Leidenschaft zu schreiben möchte sie naturwissenschaftliche Inhalte fachlich fundiert, empathisch und verständlich an Interessierte vermitteln. [mehr]
Quellen
- Praxishandbuch Angiographie: Spektrum der Diagnostik und Interventionen; 2. Auflage 2008, Kartonierte Sonderausgabe 2014 - Autor: Goldyn, Gerd L. - Publikation: Springer-Verlag Berlin Heidelberg - ISBN: 978-3-662-44891-5
- Pschyrembel Klinisches Wörterbuch; 266. aktualisierte Auflage; 2014 - Autoren: Pschyrembel, Willibald; Arnold, Ulrike - Publikation: Walter de Gruyter & Co. Verlag; Berlin
- Duale Reihe Chirurgie; Kapitel: Zerebrale Angiografie - Autoren: Barth, Harald; Schön, Ralph - Publikation: Georg Thieme Verlag KG Stuttgart 2012 - DOI: 10.1055/b-002-89583
- Angiofibel: Interventionelle angiographische Diagnostik und Therapie; 2. vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage (2021); Kapitel 1: Aufklärung - Autoren: Eiers, Michael; Heberer Jörg - Publikation: Springer Verlag Berlin Heidelberg - ISBN: 978-3-662-56242-0
- Duale Reihe Radiologie, 4., vollständig überarbeitete Auflage - Autoren: Reiser, Maximilian; Kuhn, Fritz-Peter; Debus, Jürgen - Publikation: Georg Thieme Verlag Stuttgart 2017 - DOI: 10.1055/b-004-132212
- Patientenaufklärung Angiographie der Hals-Kopf-Gefäße; Klinikum Fulda Radiologie-Zentrum - URL: https://klinikum-fulda.de/wp-content/uploads/2017/03/RAD-PIN-Patientenaufklaerung-Angiographie-Kopf-Hals-Gefaesse-03-0.pdf (abgerufen am 13.10.2025)
- CT-Angiographie in München; Radiologie München - URL: https://www.radiologie-muenchen.de/radiologie/angiographie/ct-angiographie/ (abgerufen am 13.10.2025)
- Angiographie (DSA); RWTH Aachen - URL: https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/klinik-fuer-diagnostische-und-interventionelle-radiologie/fuer-patienten/angiographie-dsa/ (abgerufen am 13.10.2025)
- Wissenswertes rund um die Angiographie; Helios Gesundheitsmagazin - URL: https://www.helios-gesundheit.de/magazin/news/02/angiografie/ (abgerufen am 13.10.2025)
- Angiographie; MSD Manuals. - Autor: Mafraji, Mustafa A - URL: https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/spezielle-fachgebiete/grundz%C3%BCge-der-radiologischen-bildgebung/angiographie (abgerufen am 13.10.2025)
- Angiographie; Primo Medico - URL: https://www.primomedico.com/de/behandlung/angiografie/ (abgerufen am 13.10.2025)
- Angiographie der Kopf- und Halsarterien; Universitätsklinikum Düsseldorf - URL: https://www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/institut-fuer-diagnostische-und-interventionelle-radiologie/neuroradiologie/diagnostische-neuroradiologie/angiographie-der-kopf-und-halsarterien (abgerufen am 13.10.2025)
- Herzkatheter-Koronarangiografie; Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten - URL: https://www.internisten-im-netz.de/untersuchungen/herzkatheterkoronarangiografie.html (abgerufen am 13.10.2025)
- Das Herzkatheterbuch: Diagnostische und interventionelle Kathetertechniken - Autor: Lapp, Harald (2019) - Publikation: Georg Thieme Verlag Stuttgart - DOI: 10.1055/b-006-160381
- Phlebographie - Varikographie - Autor: Müller-Wille, René - URL: https://www.compgefa.de/wissen/phlebographie-varikographie (abgerufen am 13.10.2025)
- Angiografie; Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten - URL: https://www.internisten-im-netz.de/untersuchungen/angiografie/ (abgerufen am 13.10.2025)
- Farbkodierte Duplexsonographie (FKDS) in der Diagnostik von Gefäßerkrankungen - Autoren: Bley, Thorsten; Kuhlencordt, Peter; Kubale, Reinhard - URL: https://www.springermedizin.de/emedpedia/detail/operative-und-interventionelle-gefaessmedizin/farbkodierte-duplexsonographie-fkds-in-der-diagnostik-von-gefaesserkrankungen?epediaDoi=10.1007%2F978-3-662-45856-3_21 (abgerufen am 13.10.2025)


